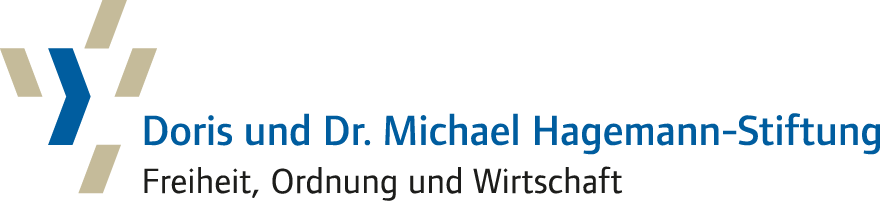Stiftungstag
am Donnerstag dem 8. Dezember 2011
von 9:30 bis ca. 18:15 Uhr:
Ordnungspolitische Herausforderungen in der Schuldenkrise:
Ist der Euro noch zu retten?
Veranstaltungsort:
Studentenwerk Marburg im Mensagebäude, Erlenring 5, 35037 Marburg
Programm
| 9:30 Uhr | Begrüßung und Grußworte |
| 10:00 Uhr | Was wird aus dem Euro? Claus Döring |
| 10:45 Uhr | Pause |
| 11:00 Uhr | Währungspolitik in der Krise Prof. Dr. Alfred Schülle |
| 11:45 Uhr | Mittagspause, Bistro des Marburger Studentenwerkes |
| 13:15 Uhr | Insolvenz von Staaten in der Eurokrise Prof. Dr. Dirk Wentzel |
| 14:00 Uhr | Makroökonomie in der Krise? Prof. Dr. Bernd Hayo |
| 14:45 Uhr | Pause |
| 15:00 Uhr | Markt und Moral – hat unsere Wirtschaftsordnung versagt? Dr. Jörn Quitzau |
| 16:00 Uhr | Ist der Euro noch zu retten? Zu den Möglichkeiten und Grenzen staatlichen Handelns Dr. Hermann Otto Solms |
| 17:15 Uhr | Podiumsdiskussion: Wege aus der Euro-Schuldenkrise: Freiheit oder Interventionismus? Podiumsteilnehmer: Claus Döring, Prof. Dr. Dirk Wentzel, Dr. Jörn Quitzau, Dr. Hermann Otto Solms, Dr. Wolfgang Glomb Moderation: Prof. Dr. Sascha Mölls |
In der ganztägigen Veranstaltung werden sich Praktiker, Wissenschaftler, Finanzexperten und Politiker äußern zum Stand und der Entwicklung des Euro.
Es sollen Antworten gegeben werden auf die Fragen:
Was wird aus dem Euro? Welche Werkzeuge bietet die Währungspolitik? Ist die gesamtwirtschaftliche Steuerung noch angemessen? Sollen Staaten infolge ihrer Schuldenpolitik die Insolvenz erklären? Haben Markt und Moral versagt?
Die abschließende Podiumsdiskussion mit den Vortragenden und Währungsfachleuten erörtert Wege aus der EU-Schuldenkrise. Während des Stiftungstages besteht die Gelegenheit zur Diskussion und zum Austausch mit den Referenten sowie anderen Teilnehmenden.
Anmeldung erbeten bitte bis zum 1. Dezember 2011, gern per E-Mail: info(at)hagemann-stiftung-ordnungspolitik.de
Vorträge
„Europa ist wie ein Fahrrad. Hält man es auf, fällt es um.“
Mit diesem Zitat von Jacques Delors, dem langjährigen Präsidenten der EG-Kommission und einem der Väter der Europäischen Währungsunion und des Maastricht-Vertrages möchte auch ich Sie zum heutigen Stiftungstag ganz herzlich begrüßen.
Mein Name ist Claus Döring, ich bin Chefredakteur der Börsen-Zeitung, und damit von Berufs wegen täglich mit dem Zustand der EWU und des Euro, mit dem Handeln (oder Nichthandeln) der Politik und der Reaktion der Finanzmärkte beschäftigt.
Wohl wegen dieses Generalisten-Status bin ich gefragt worden, ob ich den Auftakt-Vortrag zum heutigen Stiftungstag übernehmen würde, ehe dann die Fachleute aus der akademischen Welt folgen. Gerne bin ich der Einladung hierzu gefolgt, zumal ich bisher die Uni hier in Marburg nur von außen kenne und das Timing für das Thema des Stiftungstages kaum besser hätte sein können.
Zurück zum Bild von Jacques Delors und dem Fahrrad. Zu viele haben diesem Fahrrad in den vergangenen Jahren in die Speichen gegriffen und die Fahrt gebremst, haben Hindernisse in den Weg gelegt. Es ist ins Wanken geraten und droht nun in der Tat umzufallen, wenn sich niemand findet, der wieder kräftig in die Pedale des europäischen Einigungsprozesses tritt.
Was wird aus dem Euro? Überlebt Euroland?
Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind die Fragen, die heute Sie hier in Marburg und morgen die Menschen in ganz Europa, ja in der ganzen Welt bewegen. Denn wir stehen heute am Vortag eines EU-Gipfels, der nun endlich den Durchbruch in der Bewältigung der Eurokrise oder besser: Staatsschuldenkrise bringen soll. Fragen, auf die wir heute in einer Reihe von Vorträgen aus unterschiedlicher Perspektive eine Antwort zu geben versuchen.
Wenn Sie in den zurückliegenden Tagen die Medien verfolgt haben, dann konnten Sie ein Spektrum der Meinungen zur Zukunft der Eurozone und Europas erleben, das widersprüchlicher nicht hätte sein können. Für die einen ist der Zerfall der Währungsgemeinschaft nur eine Frage der Zeit, wieder andere hoffen sogar darauf, und wieder andere sähen schon im Ausstieg eines der 17 Mitgliedsländer aus der Währungszone den Untergang des Abendlandes. Die einen fordern den Einsatz einer Bazooka (Panzerfaust), um die Märkte einzuschüchtern und mit großen Summen allen Spekulanten der Welt entgegen treten zu können, die nächsten empfehlen Euro-Bonds, wieder andere wollen den Rettungsschirm EFSF mit einer Banklizenz ausstatten und die nächsten wollen, dass die Europäische Zentralbank als „lender of last resort“ unbegrenzt am Markt interveniert und Staatsanleihen aufkauft. So viel Gedanken- und Sprachverwirrung hat es lange nicht gegeben in Europa, meine Damen und Herren, und der Stil der Auseinandersetzung erinnert mich manchmal an eine Zeit, in der es schon einmal eine europäische Währung gab, und die hieß damals Sesterze.
Aber Spaß beiseite, beginnen wir erst mal mit einer Begriffsklärung. Denn mit Worten macht man Stimmung und gibt Themen unterschwellig einen Spin. So wird viel von der Eurokrise gesprochen und auch unser Tagungsmotto stellt die Frage, ob der Euro noch zu retten sei. Im Kern geht es ja aber gar nicht darum, den Euro zu retten. Denn nicht der Euro muss gerettet werden, sondern einige Euro-Länder. Und, man kann es nicht häufig genug betonen, wir haben keine Währungskrise, sondern eine Staatsschuldenkrise. Von einer Währungskrise könnten wir ja nur sprechen, wenn der Außenwert oder der innere Wert der Währung in Gefahr wäre. Davon ist weit und breit nichts in Sicht: Der Außenwert ist sehr stabil, allen Horrorszenarien zum Trotz, und mit dem aktuellen Kurs gilt der Euro gegenüber seinem aufgrund von Kaufkraftvergleichen errechneten fundamentalen Wert immer noch als ca. 10 % überbewertet.
Und wie sieht es mit dem inneren Wert aus, also der Preisstabilität? Seit Einführung des Euro hatten wir in der Eurozone eine Inflationsrate von knapp 2 %, also genau auf der von der EZB angestrebten Zielmarke. Damit ist der Euro bisher stabiler, als es die D-Mark im Durchschnitt ihrer Jahre war.
Natürlich zeigen sich am Horizont Gefahren für die Preisstabilität, zur Zeit liegt die Inflationsrate in Euroland ja auch bei 3 %. Doch die Inflationserwartung ist stabil, die EZB erwartet für 2012 eine Rate unter 2 %. Denn der Ausblick auf eine „milde Rezession“, wie EZB-Präsident Mario Draghi es bei seinem ersten Auftritt in Frankfurt nach der Zentralbankratssitzung formulierte, diese milde Rezession setzt Löhne und Kosten unter Druck und verhindert anziehende Preise.
Wenn diese Analyse stimmt – und sie wird von den meisten Bankenvolkswirten geteilt wie auch vom Chefvolkswirt der EZB, Jürgen Stark, der ja als Zinsfalke bekannt ist, wenn also diese Analyse stimmt, dann hat Draghi mit der überraschenden Zinssenkung vor 4 Wochen keine Wende in der EZB-Politik vollzogen, sondern den bisherigen Kurs fortgesetzt. Und auch eine weitere Zinssenkung, die die meisten ECB-Watcher für den heutigen Tag erwarten, wäre so zu begründen.
In anderer Hinsicht scheinen bei der EZB mit Draghi aber dann doch neue Zeiten angebrochen zu sein. Ich meine die Neigung, mit sogenannten „unkonventionellen“ Maßnahmen an den Märkten einzugreifen und damit erstens den Banken quasi unbegrenzt Liquidität zur Verfügung zu stellen und zweitens – und das ist das aus meiner Sicht Gefährliche – in großem Stil weiterhin Staatsanleihen südeuropäischer Länder aufzukaufen, insbesondere italienische. Insgesamt hat die EZB inzwischen für mehr als 200 Mrd. Euro Staatsanleihen der Schuldenstaaten aufgekauft. Wenn die EZB in diesem Stil weiter macht, dann werden es Ende nächsten Jahres 500 Mrd. Euro sein, hat dieser Tage das Research der Deka Bank errechnet. Plastisch gesprochen wäre damit aus dem Fort Knox des Euro eine Bad Bank geworden, meine Damen und Herren.
Was das im Falle eines Defaults – das Thema Insolvenz von Staaten in der Eurokrise haben wir ja später noch - was das also in einem solchen Fall für die EZB heute schon bedeuten würde, dürfte jedem klar sein: Das Eigenkapital der EZB bzw. des Systems der Europäischen Zentralbanken von 81 Mrd. Euro wäre schnell aufgebraucht, der Präsident müsste die Staaten um neues Kapital bitten. Dann wäre es um die Unabhängigkeit der EZB von der Politik auch für jeden sichtbar geschehen. Die Staaten der Eurozone wären ihr eigener „Lender of last resort“, oder anders ausgedrückt: der Staatsfinanzierung durch die Notenpresse wäre Tür und Tor geöffnet.
Die wirtschaftshistorisch Beschlagenen unter Ihnen wissen, dass schon zwei frühere Anläufe zu einer europäischen Währungsgemeinschaft an der Monetarisierung der Staatsschulden gescheitert sind. Das war so bei der 1865 von Frankreich, Belgien, Italien, der Schweiz und Griechenland gegründeten lateinischen Münzunion, die 1914 faktisch zerbrach, und das war so bei der 1872 gegründeten skandinavischen Münzunion, die 1924 ihr Ende fand. In beiden Fällen waren die hohe Staatsverschuldung in einigen Teilnehmerstaaten und deren anschließende Monetarisierung die wesentliche Ursache fürs Scheitern. Es ist also zu billig, nur eine angeblich übertriebene Inflationsfurcht der Deutschen als Ursache für den kompromisslosen Stabilitätskurs zu kritisieren. Es sind vielmehr die Erfahrungen aus anderen Währungsgemeinschaften außerhalb Deutschlands, die für eine Schuldenbremse und institutionelle Vorkehrungen gegen ungehemmtes Schuldenmachen sprechen.
Angesichts der Schwierigkeiten, in denen die Europäische Währungsunion zurzeit steckt, sehen sich Ökonomen bestätigt, die von Anfang an meinten, die europäischen Länder seien nicht in einem Zustand, der den Verzicht auf flexible Wechselkurse erlaube. Hinter diesen Aussagen stand eine recht schematische Variante der Theorie optimaler Währungsräume. Es kann allerdings keine Rede davon sein,
dass die Probleme den Schöpfern der Währungsunion damals nicht bekannt waren. Es war ein Experiment, und gewiss ein gerade unter Ökonomen sehr umstrittenes. Sie erinnern sich bestimmt noch an die Aufrufe und öffentlichen Schreiben von VWL-Professoren, die vor mehr als 20 Jahren davor warnten, das Pferd gewissermaßen von hinten aufzuzäumen.
(Manche der damaligen Euro-Gegner haben bekanntlich den Klageweg zum Bundesverfassungsgericht beschritten).
Die meisten Ökonomen waren damals Anhänger der Krönungstheorie, wonach erst am Ende des politischen Einigungsprozesses die gemeinsame Währung stehen sollte. Ein starker Anwalt dieser Gruppe war nicht zuletzt die Deutsche Bundesbank. Deren damaliger Chefvolkswirt und späterer EZB-Chefvolkswirt Otmar Issing – Generationen von WiWi-Studenten haben seine Lehrbücher über Geldtheorie und Geldpolitik verinnerlicht – die besondere Situation 1991 so beschrieben, ich zitiere: „Es gibt in der Geschichte kein Beispiel für eine dauerhafte Währungsunion ohne deren Garantie durch einen Staat.“
Diese Problematik war natürlich auch den Politiker bekannt, die eher Anhänger der Katalysatortheorie waren, also von der Einführung einer gemeinsamen Währung Schubkraft für den Weg zur politischen Union erhofften. Deshalb haben sie das gesamte Regelwerk der EWU darauf angelegt, das Funktionieren der Währungsunion sicher zu stellen. Die Störungen, zu denen es jetzt gekommen ist, rühren daher, dass die Regeln nicht eingehalten worden sind.
In der Lage, in die die EWU nun geraten ist, ist aber bereits so großer Schaden entstanden, dass es wohl nicht mehr ausreicht, darauf zu bestehen, dass die Regeln künftig eingehalten werden. Vielmehr bedarf es nun schärferer Regeln und vor allem wirksamer Sanktionen, am besten automatischer Sanktionen.
Die laufende Schulden- und Vertrauenskrise lässt sich nur in den betroffenen Ländern selbst lösen. Aktuell können aber Institutionen wie die EZB oder der IMF die notwendige Zeit erkaufen, um es den Ländern zu ermöglichen, die notwendigen Sparbeschlüsse zu implementieren.
Wo wir heute in der Krisengeschichte stehen, veranschaulicht eine Grafik, die ich dem Research der Deka Bank entnommen habe:
Kommen wir zunächst zur Rolle der EZB und zu den notwendigen Veränderungen dort.
Erstens sollte die EZB die Käufe von Staatsanleihen umgehend einstellen. Denn sie erhöhen das Risiko des Vertrauens- und Reputationsschadens enorm, ohne dass dem ein nennenswerter positiver Effekt gegenüber stünde.
Sehen Sie sich mal die Entwicklung der Rendite der Staatsanleihen an, die jüngst so massiv von der EZB gekauft wurden! 10jährige italienische Staatsanleihen rentierten trotz der massiven EZB-Käufe vor einigen Wochen bis zu 7,5 % auf Rekordniveau. Gegen den Vertrauensentzug der Marktteilnehmer bei einzelnen Peripheriestaaten kann die EZB nicht anstinken. Erst geänderte politische Weichenstellungen sorgen an den Märkten für Entspannung. Das beste Beispiel ist wieder Italien, wo der Konsolidierungskurs des neuen Regierungschefs Mario Monti dafür gesorgt hat, dass die Rendite wieder auf ca. 6 % gesunken ist.
Das Dilemma, in das sich die EZB mit den Anleiheaufkäufen hineinmanövriert hat, haben der damalige Bundesbank-Präsident Axel Weber und EZB-Chefvolkswirt Jürgen Stark klar erkannt und vorausgesehen. Weber hat sofort die Konsequenzen gezogen, im Mai 2010, Stark erst jetzt, als die Aufkäufe auf spanische und vor allem italienische Anleihen ausgedehnt wurden.
Zweitens sollte die EZB sich strikt auf die Geldwertstabilität und die internationale Finanzmarktstabilität konzentrieren und nicht den Konjunkturstimulator spielen oder monetäre Staatsfinanzierung betreiben wollen. Das ist erstens nicht ihr Auftrag und das steht zweitens ganz schnell im Zielkonflikt mit der Geldwertstabilität. Wenn man da die Büchse der Pandora öffnet – und der Griff nach den Schätzen der Bundesbank wie z.B. den Sonderziehungsrechten beim IWF und nach den Goldreserven wäre das gewesen – ist es um die Stabilitätskultur und die Unabhängigkeit geschehen. Die Bürger Eurolands würden das Vertrauen in die EZB verlieren, vor allem die Deutschen, die in der EZB die Nachfolgerin der Bundesbank sehen. Der von mir eingangs zitierte Jacques Delors hat einmal festgestellt: „Nicht alle Deutschen glauben an Gott, aber alle glauben an die Bundesbank."
Zur Geldwertstabilität gehört, dass man eine „vorausschauende“ Zinspolitik betreibt. So wurde die Zinssenkung in der vorigen Woche begründet. Fakt ist aber, dass die Wirtschaft in Euroland keine Finanzierungsengpässe hat, eine Kreditklemme nirgendwo in Sicht ist und man sich schon die Frage stellen muss, ob ein negativer Realzins, wie wir ihn jetzt in Deutschland haben, die richtigen Anreize zum sparsamen Haushalten setzt.
Dass Bankenvolkswirte trotzdem von den Zinssenkungen begeistert sind, darf nicht wundern. Denn es ist ein Geschenk der EZB an die Banken, die sich somit noch günstiger refinanzieren können bzw. eine Chance aufs Überleben haben. Volkswirtschaftlich sind die Senkungen problematisch. Angesichts der konjunkturellen Abkühlung sei der Hinweis auf Inflationsgefahren so überflüssig wie die Warnung vor Radarfallen auf der Autobahn, wenn man selbst im Stau steckt. Das mag aktuell so sein. Aber keiner weiß, wann der Stau zu Ende ist und oft wird gerade dann zu schnell gefahren.
Drittens muss die Governance in der EZB geändert werden. Es kann nicht sein, dass im EZB-Zentralbankrat der Notenbankchef von Malta oder Luxemburg dieselbe Stimme hat wie der Präsident der Deutschen Bundesbank. Für die Verpflichtungen der EZB steht Deutschland mit 27% ein. Daran muss auch das Stimmrecht im Entscheidungsgremium gekoppelt sein. Beim IWF ist das ja auch so.
Viertens sollte sich die EZB von den Staatsanleihen trennen und sie an den EFSF verkaufen, sofern der Rettungsschirm dazu volumenmäßig noch in der Lage ist.
Damit bin ich beim Rettungsschirm EFSF und dessen Rolle.
Grundsätzlich ist die Idee richtig, für die Eurozone einen solchen Fonds zu gründen, der erstens demokratisch legitimiert ist und politischer Kontrolle unterliegt (anders als EZB) und zweitens Hilfe nur wie der IWF konditioniert, also mit Auflagen, zur Verfügung stellt.
Richtig ist in meinen Augen, dass der EFSF mit einem großen Volumen ausgestattet sein muss, sonst wird er an den Märkten nicht ernst genommen. Dass das ursprüngliche effektive Kreditvolumen von etwa 250 Mrd. Euro zu knapp kalkuliert war, ist offensichtlich. Damit es auf effektiv 440 Mrd. Euro steigen konnte, haben die Euro-Länder ihre Garantien von 440 auf 780 Mrd. Euro erhöht, der deutsche Anteil ist von 123 auf 211 Mrd. Euro gestiegen.
Auch das wäre zu wenig, wenn beispielsweise Italien geholfen werden müsste. Aber ich bin nicht der Meinung, dass Italien überhaupt geholfen werden muss, schließlich ist das ein reiches Land mit einer gesunden Wirtschaftsstruktur, das aus eigener Kraft das Schuldenproblem lösen könnte, wenn es wollte.
Bisher wollte man gar nicht so recht, weil man mit dem eigenen, italienischen Geschäftsmodell recht gut gefahren ist. Es funktioniert grob skizziert so, dass es einen gesellschaftlichen Konsens dergestalt gibt, dass der Staat viele Aufgaben übernimmt und sich verschuldet, aber die Privaten schont. Dem steht das angelsächsische Modell gegenüber, in dem der Staat sich zurückhält und viele Aufgaben und Lasten der private Sektor trägt. In der Krise haben wir gesehen, dass dann private Schulden schnell umschlagen können in öffentliche Schulden, man also immer beides zusammen betrachten sollte. Zum Beispiel hat Italien privates Vermögen in Höhe von 175 % des BIP, in Deutschland sind es nur 127 %.
Aber wenn man in Euroland mit dem EFSF zumindest theoretisch dazu in der Lage sein will, auch Schuldenländer wie Italien zu retten, braucht man große Feuerkraft, also die viel zitierte Bazooka (Panzerfaust). So ist die Idee der Hebelung auf ein Volumen bis zu 2 Bill. Euro entstanden, weil man noch mehr als die 780 Mrd. Garantievolumen des EFSF den Euroländern und ihren Steuerzahlern nicht zumuten zu können glaubte. Ein gefährlicher Plan, weil er zwar formal die Haftungssumme nicht erhöht, aber die Eintrittswahrscheinlichkeit erheblich nach oben setzt, in Haftung genommen zu werden. Und noch etwas möchte ich zu bedenken geben, nämlich die Gefahr, dass ein riesiger Bestand an Finanzmitteln als Einladung verstanden werden kann, auch „genutzt“ zu werden. Mit der Höhe der Mittel wächst der politische Druck, diese Gelder auch einzusetzen. Das sagt mir die Lebenserfahrung.
Durch den EFSF hat sich die Schuldenquote der Deutschen schon jetzt auf 90 % des BIP erhöht. Und wenn immer mehr Staaten dem EFSF zur Last fallen, stünde Deutschland am Ende rechnerisch bei einer Schuldenquote von 314 % des BIP. Schlüpft beispielsweise Spanien in den Fonds sind es 100 % und fällt auch Italien, wären es 130 %.
Diese Gefahren werden natürlich von der Politik verschleiert, erst recht, wenn dazu ein SPV, ein Special Purpose Vehicel, gegründet wird.
Es ist ein Treppenwitz der Geschichte, meine Damen und Herren, dass jetzt die Politiker ausgerechnet zu solchen außerbilanziellen Vehikeln greifen wollen, die wesentlich zur Bankenkrise von 2008 beigetragen haben und an deren Folgen wir heute noch leiden. Ob SPV, Versicherungslösung oder gar Banklizenz für den EFSF – der frühere Bundesbankpräsident Axel Weber hat es jüngst bei einem Vortrag in Frankfurt auf den Punkt gebracht, ich zitiere:
„Wir haben es uns in Europa anderthalb Jahre geleistet, über irrelevante Alternativen zu reden. Alle bisherigen Ideen laufen nach dem Motto, wie kann ich das Geld der anderen verwenden, um mir selbst zu helfen.“
Wie man Hilfe und Selbsthilfe, Haushaltsdisziplin und Schuldenabbau vielleicht doch in eine tragfähige Konstruktion bringen kann, haben kürzlich die Fünf Wirtschaftsweisen vorgestellt.
Dabei handelt es sich um einen Schuldentilgungspakt, der Zuckerbrot und Peitsche verbindet. Die Vorteile von Eurobonds, nämlich niedrigere Zinsen für geschwächte Eurostaaten, werden mit strikten Verschuldungsauflagen verknüpft. Ich will hier nicht in die Details gehen, die können Sie ja an verschiedenen Stellen nachlesen. Der Vorschlag, den die Bundeskanzlerin umgehend als nicht praktikabel zurückgewiesen hat, krankt an einem entscheidenden Punkt: Welche Instanz soll die Einhaltung überwachen? Schon beim geschärften Stabilitätspakt konnte ja das Vorhaben automatischer Sanktionen bei Verstößen nicht durchgesetzt werden.
Von Winston Churchill stammt der Satz: „Die Amerikaner tun immer das Richtige, aber erst, nachdem sie alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft haben.“ Meine Damen und Herren, ich habe den Eindruck, das Gleiche kann man heute über die Europäer sagen. Seit zwei Jahren wird eine Eurorettungs-Sau nach der anderen durchs Dorf gejagt, besonderer Beliebtheit erfreuten sich dabei die sog. Euro-Bonds. Inzwischen ist auch die Politik dort angekommen, wo Ökonomen und Währungsfachleute schon vor zwei Jahren waren: Beim Schuldenschnitt für Griechenland und der Beteiligung der Bondholder, sprich privaten Gläubiger. Die Käufer von griechischen Staatsanleihen müssen sich mit dem Gedanken vertraut machen, dass ihre Investments Fehlinvestitionen gewesen sind. Mitleid habe ich da keines. Wer Renditen im zweistelligen Prozentbereich einstreicht, muss wissen, dass ein solches Investment ein entsprechendes Risiko bedeutet. Viel zu lange haben Investoren geglaubt, es gäbe vielleicht doch ein „free lunch“, viel zu leichtfertig wurde das No-Bail-out-Gebot missachtet, erst in der Bankenkrise und dann in der Staatsschuldenkrise.
Dabei musste jedem beim Blick auf die Schuldenquote von 170 % und die wirtschaftliche Verfassung Griechenlands klar sein, dass am großen Schnitt kein Weg vorbeiführen würde, und dass ein schneller Schnitt ein - ökonomisch betrachtet – ein besserer Schnitt ist. Nur die Politiker in den Euroland-Regierungen und in Brüssel scheuten schon das Wort wie der Teufel das Weihwasser und sahen nicht nur Euroland, sondern die EU in Gefahr. Deswegen auch nur ein halbherziger erster Schritt von 21 %, der sich schnell als viel zu niedrig herausstellte. Doch selbst die jetzt geplanten 50 % freiwilliger Verzicht werden nicht ausreichen, damit Griechenland wieder auf eigene Beine kommt. Da viele öffentliche Gläubiger wie EZB und EIB außen vor bleiben, reduziert sich die Staatsschuld Griechenlands nur auf 120 % des BIP. Auch damit, meine Damen und Herren, wird Griechenland überfordert sein und noch auf viele Jahre am Tropf der Gläubigerländer hängen. Vermutlich ist eine noch stärkere Entlastung der griechischen Finanzen und Schuldenschnitt nötig, verknüpft mit weitgehenden strukturellen Reformen und einer Art Marshallplan für das Land.
Gleichwohl sollte man in der Politik keine Option ausschließen, und dazu gehört auch, dass man Griechenland droht, bei Nichteinhaltung des vom neuen Regierungschef Papademos eingeschlagenen Reformkurses das Land aus der Eurozone zu schmeißen. Das ist zwar nach den Verträgen nicht möglich, weil sich niemand die eingetretene Entwicklung vorstellen konnte und es keine Regeln für das geordnete Verlassen der Eurozone gibt. Aber wann hat sich Politik, wenn es Spitz auf Knopf kommt, schon an Verträge gehalten, die aus politischen Schönwetterperioden stammen? Gewiss, ein Austritt aus der Eurozone wäre für Griechenland der ungeordnete Staatsbankrott. Denn eine Insolvenzordnung für die Euro-Länder wird es erst mit dem ESM (Europäischer Stabilitätsmechanismus) geben, der 2013 als dauerhafte Lösung das vorläufige EFSF-Regime ablösen soll und jetzt vielleicht schon Ende 2012 kommt.
Aber dieser Staatsbankrott und die Rückkehr zur nationalen Währung wäre für Griechenland so etwas wie die Reset-Taste. Freilich würde sich das Land in kurzer Zeit auf dem Wohlstandsniveau der 60er Jahre wiederfinden, kurz gesagt: arm, aber vielleicht glücklich.
Ein solcher Bankrott Griechenlands käme die Gläubiger, insbesondere die Banken, und auch die Steuerzahler Eurolands vorübergehend teurer zu stehen als die beim letzten Gipfel vereinbarten Rettungsmaßnahmen. Aber so riesig groß wäre der Unterschied nicht, wenn man es genauer betrachtet. Was bedeutet denn die freiwillige Umschuldung von 50 %? Die Banken haben nicht nur die Wertberichtigung in dieser Höhe, sondern sie müssen auch noch Abschreibungen auf die verbliebenen 50 % vornehmen, die ja weiterhin auf Euro lauten und mit Sicherheit am Markt nicht zu 100 % notieren werden. Da mit dem Schuldenschnitt die Schuldenquote sich nur auf 120 % des BIP reduziert und jeder wissen kann, dass auch das Griechenland überfordert, ist mindestens mit einer weiteren Abschreibung von 50 % zu rechnen. Dann wären also schon 75 % weg. Bis zur Totalabschreibung ist es nicht mehr weit.
Und der Steuerzahler in Euroland? Der müsste schlechtem Geld nicht länger gutes Geld hinterher werfen. Der Schuldenschnitt würde ihn zweifelsohne viele Milliarden kosten, als Eigenkapitalzufuhr bei der EZB, als Verlustausgleich bei der EIB und eventuell als Rekapitalisierung mancher privaten Bank, die bei einer Griechenland-Pleite umkippen würde. Aber nach dem Ende mit Schrecken wäre Schluss und es wäre vor allem ein Zeichen gesetzt, dass die Solidarität in einer Gemeinschaft auch Grenzen hat und nur funktioniert, wenn alle die Spielregeln einhalten.
Apropos Spielregeln. Lassen Sie uns an dieser Stelle einen Vergleich heranziehen. Nehmen wir einmal an, ein Paar hat bei der Eheschließung Gütertrennung vereinbart. Was passiert nun, wenn einer der Ehepartner gegen diesen Vertrag verstoßen hat und der andere ihm finanziell unter die Arme greifen musste? Eine Möglichkeit wäre natürlich, die Vertragsbedingungen zu ändern und zukünftig in Gütergemeinschaft zu leben. Eine unter den gegebenen Umständen wenig wahrscheinliche Lösung. Eine weitere Option wäre, am alten Vertrag festzuhalten und eine Änderungsklausel aufzunehmen, die eine gemeinsame Haftung ausschließt. Glaubwürdig wäre dies allerdings nur, wenn derjenige Partner, der sich des Vertragsbruchs schuldig gemacht hat, selbst im Falle der Insolvenz in Zukunft auf jegliche finanzielle Unterstützung durch den anderen verzichten würde. Langfristig gesehen würde die Ehe danach wohl auf solideren Füßen stehen, doch möglicherweise ist der finanziell schwächere Partner gar nicht bereit, eine Insolvenz in Kauf zu nehmen. Dann bliebe nur, die Ehe ohne Vertrag fortzusetzen. Eine Scheidung würde damit zunächst vermieden. Angesichts des Vertrauensverlust und zunehmenden Misstrauens dürfte es jedoch letztlich nur eine Frage der Zeit sein, bis die Ehe geschieden wird.
In einem ähnlichen Dilemma wie das Ehepaar steckt die EWU. Entweder es kommt zu einer politischen Union und hierfür müsste der morgige Gipfel echte Fortschritte bringen, oder aber wir müssten zurück auf Los, sprich zum ursprünglichen Maastricht-Vertrag. Das hieße Rückbesinnung auf die Grundprinzipien des vertraglich vereinbarten und noch grundsätzlich bestehenden Systems mit europäischen Regeln für die nationalen Finanzpolitiken, prinzipiell fiskalisch eigenverantwortlichen Staaten, einem weitgehenden Haftungsausschluss und einer Disziplinierung der Finanzpolitik durch die Finanzmärkte.
Wir brauchen hierfür einen rigiden Stabilitätspakt. Es kann doch nicht sein, dass Staaten vor der Aufnahme in die Währungsunion zahlreiche Anforderungen erfüllen müssen, es für die Zeit danach aber nur einen Pakt gibt, dessen Einhaltung niemand mehr richtig ernst nimmt und dessen Verstöße kaum sanktioniert werden! Letztlich ist es Aufgabe der Schuldenländer, das Vertrauen der Anleger durch eine konsequente Stabilisierungspolitik wiederzugewinnen. Der Beitrag der Krisenländer zur Solidität muss dabei höher sein als der Solidaritätsbeitrag der anderen Euro-Staaten.
Aus deutscher Sicht ist es dabei unabdingbar, dass für jedes einzelne Land starke Anreize erhalten bleiben, sich stabilitätsgerecht zu verhalten. Momentan stellen die hohen Zinsen, die die überschuldeten Länder an den Kapitalmärkten zu zahlen haben, einen solchen Anreiz dar, der auch Wirkung zeigt – ganz im Sinne einer Währungsunion,
die keine Transferunion sein will. Auch die deutsche Ablehnung von Euro-Bonds ist vor diesem Hintergrund zu sehen. Tatsächlich ist die EWU während der aktuellen Krise bereits in beträchtlichem Maß zu einer „wildwüchsigen“ Transferunion geworden, in der die starken Länder die schwachen mit Zuwendungen und Garantien unterstützen. Das Ausmaß des gegenseitigen Beistands wird sich nicht mehr auf Null zurückdrehen lassen, aber das Ziel sollte sein, klare Regeln und Mechanismen dafür zu entwickeln, statt sich – wie in den letzten Monaten – vom Druck der Ereignisse zu eigentlich vertragswidrigen Notmaßnahmen treiben zu lassen.
Die andere Möglichkeit liegt in einem großen Sprung, der einen grundlegenden Wechsel der föderalen Ausgestaltung in der EU bedeuten würde. Hierbei wären bisher auf nationaler Ebene liegende Verantwortungen – insbesondere für die Möglichkeit zur Kreditaufnahme und Verschuldung – auf eine europäische Ebene zu verschieben. Dazu müssten wir in Euroland aber endlich in die Puschen kommen und bereit sein, die europäischen Verträge entsprechend zu ändern. Der amerikanische Ökonom Kenneth Rogoff (einst IWF-Chefvolkswirt, Harvard-Prof., Buch über Krisen) hat es jüngst in einem Interview mit der Börsen-Zeitung auf den Punkt gebracht: Die Europäer bräuchten eine „shotgun marriage“, wie er sagte, man müsse 20 Jahre Evolution in zwei Jahren schaffen.
Die Vorstellung einer europäischen Fiskalunion und der Gedanke an die Abgabe von Souveränität mag manchen beunruhigen angesichts der Erfahrungen mit Entscheidungen aus dem fernen Brüssel. Schon der Begriff einer europäischen Wirtschaftsregierung hat zumindest in Deutschland die Bürger verschreckt. Deshalb sollte sich die Kompetenzverlagerung auf das absolute Minimum beschränken, beispielsweise auf Obergrenzen für die künftige Kreditaufnahme und auf Eingriffsrechte zur Gewährleistung des Schuldenabbaus. Diese Eingriffsrechte müssten aber so weit gehen, dass die nationalen Ebenen ihre fiskalpolitische Souveränität spätestens dann verlieren, wenn die Defizit- und Verschuldungsgrenzen nicht eingehalten werden. Das Haushaltsrecht der nationalen Parlamente würde unter den Vorbehalt der Zustimmung durch eine zentrale europäische Institution gestellt.
Im Gegenzug könnte und sollte der Subsidiaritätsgedanke stärker beachtet werden. Keineswegs wäre mit einer Fiskalunion zwangsläufig eine Haftungsgemeinschaft oder eine Vereinheitlichung der Steuerpolitik verbunden. Selbst in den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es keine Haftung des einen Bundesstaates für den anderen. Wenn Kalifornien das Geld ausgeht, was mit schöner Regelmäßigkeit geschieht, muss es sich selber helfen. Beispielsweise kauft nicht einmal die Fed kalifornische Staatsanleihen auf. Auch in Euroland könnten im Rahmen eines strikten Regelwerks für Verschuldungsobergrenzen also nationale Spielräume zur Haushaltsgestaltung bestehen.
Die Politiker (und die Bürger) müssen sich jetzt für einen der beiden Wege entscheiden. Der Mittelweg aus einer zunehmenden Vergemeinschaftung der Haftung bei weiterhin eigenständigen, nationalen Fiskalpolitiken droht an seinen Inkonsistenzen zu scheitern.
Die Schuldenkrise und ihre Bewältigung und damit die Neugestaltung der EWU und ihrer Institutionen ist eine große ordnungspolitische Herausforderung und Aufgabe. Ihr müssen sich die Politiker morgen beim EU-Gipfel stellen, ihr sollte sich aber auch die Wissenschaft intensiver annehmen. Ich wünschte, es würden von der heutigen Veranstaltung entsprechende Impulse ausgehen.
Und hoffen wir, dass die Stabilitätskultur stärkeren Einzug in die zu ändernden europäischen Verträge hält. Denn immerhin ist die Stabilitätskultur eine alte europäische Erfindung, und das lässt doch hoffen.
Ich zitiere: „Der Staatshaushalt muss ausgeglichen sein. Die öffentlichen Schulden müssen verringert werden. Die Zahlungen an ausländische Regierungen müssen verringert werden, wenn der Staat nicht bankrott gehen soll“. Zitat-Ende.
Das Zitat stammt nicht etwa von Angela Merkel, sondern von Marcus Tullius Cicero, 55 v. C.
Ich danke Ihnen.
ORDO_anno Beck und Dirk Wentzel
Erstpublikation im ORDO
Ordnungspolitische Überlegungen zu einer Insolvenzordnung für Staaten
Inhalt
Insolvenzordnung für Staaten ORDO_endversionI
Staatsinsolvenz: Ökonomische und historische Beispiele............................................ 4
II. Ursachen und Folgen von staatlichen Insolvenzen................................. 6
III. Auswege aus der europäischen Staatsschuldenkrise.......................... 11
1. Inflation.................................................................................... 12
2. Währungsabwertung................................................................. 13
3. Austritt aus der EWU................................................................ 14
4. Der bail out............................................................................... 15
5. Sparen und Haushaltskonsolidierung.......................................... 16
6. Der Staatsbankrott.................................................................... 17
IV. Zur Notwendigkeit einer Insolvenzordnung für Staaten........................ 18
V. Ordnungspolitischer Rahmen: Ziele und Gestaltungsprinzipien für eine Insolvenzordnung.......................................................................... 20
VI. Grundmuster einer Insolvenzordnung für Staaten............................... 21
1. Feststellung der Insolvenz......................................................... 21
2. Bindungskraft: Eine supranationale Insolvenzordnung................. 22
3. Verteilung der Lasten................................................................ 25
4. Auflagenpolitik.......................................................................... 26
VII. Folgerungen für Wirtschaftspolitik und -theorie.................................. 26
1. Mehr Verbindlichkeit.................................................................. 26
2. Mehr Transparenz.................................................................... 27
3. Das Bankenproblem.................................................................. 28
4. Das Politikproblem.................................................................... 28
5. Praktische und theoretische Einwände....................................... 28
VIII. Zusammenfassung und Ausblick.................................................... 29
Literatur........................................................................................... 30
Zusammenfassung........................................................................... 31
Summary......................................................................................... 32
I. Staatsinsolvenz: Ökonomische und historische Beispiele
Seit dem so genannten Methodenstreit der Nationalökonomie zwischen Gustav von Schmoller und Carl Menger streiten Ökonomen mit großer Leidenschaft über die Frage, ob es Gesetzmäßigkeiten in der Volkswirtschaftslehre gibt, die den Gesetzen der Naturwissenschaften gleichzusetzen wären. Bei objektiver und selbstkritischer Analyse des eigenen Fachgebietes liegt der Schluss nahe, dass die moderne Ökonomik zwar durchaus einiges erklären, gleichwohl mit Naturgesetzlichkeiten nicht aufwarten kann.
Eine der wenigen Ausnahmen dürfte das sog. Wagnersche „Gesetz der wachsenden Ausdehnung der öffentlichen bez. der Staatsthätigkeiten“ sein. Obwohl die Wagnerschen Überlegungen bereits aus dem Jahre 1892 stammen, könnten sie kaum aktueller sein: „Geschichtliche (zeitliche) und räumliche, verschiedene Länder umfassende Vergleiche zeigen, dass bei fortschreitenden Culturvölkern, mit denen wir es hier zu thun haben, regelmäßig eine Ausdehnung der Staatsthätigkeiten und der gesammten öffentlichen, durch die Selbstverwaltungskörper neben dem Staate ausgeführten Thätigkeiten erfolgt. Dies offenbart sich in extensiver und intensiver Hinsicht: der Staat und diese Körper übernehmen immer mehr Thätigkeiten und sie führen die alten und neuen Thätigkeiten immer reichlicher und vollkommener aus. (…) Der deutliche Beweis dafür liegt ziffernmässig in der Steigerung des finanziellen Staats- und Communalbedarfs vor.“ (Wagner 1892, S. 893, Heraushebungen im Original).
Was Wagner vor mehr als einhundert Jahren vermutete und als Gesetzmäßigkeit postulierte sowie mit ersten empirischen Analysen unterlegte, ist mittlerweile durch zahlreiche und umfangreiche Untersuchungen bestätigt worden: Moderne Industriestaaten haben eine ungebrochene Neigung, in jedem Jahr ihre Tätigkeiten auszuweiten und zusätzliche Finanzmittel nachzufragen. Das Wagnersche Gesetz der steigenden Staatstätigkeiten ist auch ein Gesetz der wachsenden Staatsausgaben. Es ist allerdings eine ökonomische Trivialität, dass die Staatseinnahmen kaum in gleicher Weise gesteigert wurden. Die Schere zwischen Ausgaben und Einahmen klafft immer weiter auseinander und wird üblicherweise durch Kreditaufnahme am Kapitalmarkt gedeckt. Allerdings gibt es länderspezifische Unterschiede: Manche Länder neigen stärker zu ausufernder Staatstätigkeit als andere, so dass streng methodologisch nicht von einer allgemeinen Gesetzmäßigkeit gesprochen werden kann.
In einer viel beachteten Studie haben Reinhart und Rogoff (2009) jüngst acht Jahrhunderte von Finanzkrisen in allen Kontinenten der Erde untersucht - die empirischen Fallstudien reichen vom Mittelalter bis in die Neuzeit und umfassen alle Kontinente. Im Gegensatz zu vergleichbaren früheren Studien – etwa von Kindleberger (1989) – fokussieren sich Reinhart und Rogoff primär auf eine empirische Untersuchung. Das von ihnen so genannte „this-time-is-different-syndrome“ besagt, dass die Marktteilnehmer schon kurz nach einer Finanzkrise wieder zu übertriebenem Optimismus neigen und Chancen und Risiken asymmetrisch einschätzen, weil diesmal ja alles ganz anders wäre. Diese Überschätzung der eigenen Fähigkeiten ist nicht nur ein historisches Phänomen, sondern mit der Weile auch in zahlreichen Experimenten und empirischen Untersuchungen klar nachgewiesen worden (siehe Beck 2009). Die alten Studien von Wagner (1892) wie auch die neuen und empirischen Arbeiten von Rogoff und Reinhart (2009) kommen also nach 100 Jahren im Prinzip zu genau dem gleichen Ergebnis: Staaten gehen in Konkurs und Gläubiger werden enteignet. Das war so, das ist so und es bleibt zu befürchten, dass es auch in Zukunft so sein wird. Wo ist also das Problem und was ist das eigentlich Neue an dieser Fragestellung?
Zunächst ist festzustellen, dass die Zahl der Konkurse in den vergangenen Jahren zumindest in den westlichen Industrieländern deutlich zurückgegangen ist. Zwar hat es Staatskonkurse in mehreren afrikanischen Staaten gegeben, und auch größere Staaten wie Russland und Argentinien waren in jüngster Vergangenheit betroffen, aber die Staaten Europas sind weitgehend verschont geblieben. Diesen Umstand aber so zu interpretieren, dass die Staaten offensichtlich aus ihren Fehlern der Vergangenheit gelernt hätten und zu solider und nachhaltiger Finanzpolitik übergegangen wären, ist schlichtweg falsch. Lerneffekte sind jedoch kaum vorhanden, wie etwa die jüngsten Fälle zeigen. Der Weg in die Schuldenfalle, wenn die Zinslasten ab einer gewissen Schuldenhöhe exponentiell steigen und die nationalen Haushalte zunehmend belasten und lähmen, dauert eine gewisse Zeit. In Nachkriegs-Deutschland herrschte beispielsweise unter der alliierten Besatzung ein extern ausgeübtes Verschuldungsverbot (1949-1955). Erst mit dem Stabilitätsgesetz von 1967 wurden Haushaltsdefizite legalisiert. Seitdem wächst die deutsche Staatsverschuldung jährlich und liegt jetzt schon bei 83,2 Prozent des BIP. Die tatsächliche Staatsverschuldung dürfte allerdings noch wesentlich höher sein. Die Zinslast nimmt mit rund 40 Milliarden Euro bereits den zweitgrößten Posten im deutschen Bundeshaushalt ein. Auch das im internationalen Vergleich noch relativ solide Deutschland ist also auf direktem Weg in die Schuldenfalle.
Kleinere europäische Staaten wären allerdings in jüngster Zeit schon in Konkurs gegangen, würde nicht ein engmaschiges Netz internationaler Organisationen existieren, die finanzschwachen Staaten mit Krediten unter die Arme greifen. Dies ist ein klassisches moral hazard-Problem, denn eigentlich kann man sich nur in dem Maße verschulden, wie es gelingt, Gläubiger zu finden. Nur Finanzexperten der Fachwelt wussten, dass der IWF 2009 Ungarn und Lettland still und leise vor der Zahlungsunfähigkeit bewahrte (IMF 2008a, IMF 2008b). Seitdem hat die Methode wieder an Konjunktur gewonnen, strukturelle Defizite in nationalen Haushalten vornehmlich mit internationaler Hilfe zu bekämpfen. Bei den Ländern mit akuten Finanzproblemen handelt es sich um hoch entwickelte Industrieländer (USA, einige Mitglieder der Euro-Zone), um Entwicklungsländer wie auch um aufstrebende Länder („emerging countries“). Griechenland befindet sich de facto schon im Konkurs, wenngleich de iure die Fiktion der Zahlungsfähigkeit aufrecht erhalten wurde, weil das Land unter den Euro-Rettungsschirm schlüpfte.
Die mit Griechenland beginnende Schuldenkrise enthält allerdings ein neues Element, das Wissenschaft und Politik vor besondere Probleme stellt. 27 Staaten Europas haben sich in der EU zum größten Binnenmarkt der Welt zusammengeschlossen und garantieren sich freien Güter- und Kapitalverkehr. Von den EU-Mitgliedern sind 17 Staaten zu einer Währungsunion verbunden. Der Euro entwickelte sich nach dem Dollar international zur zweitwichtigsten Reservewährung der Welt, was auch an der stabilitätsorientierten Geldpolitik der EZB liegt. Gleichwohl hat sich jedoch das ordnungspolitische Fundament des Euro, der Stabilitäts- und Wachstumspakt, als nicht glaubwürdig und tragfähig erwiesen (vgl. Wentzel 2005), so dass die langfristige Stabilität des Euro keinesfalls gesichert ist (vgl. Issing 2010). Wenn also der Euro wegen des Konkurses einzelner Mitgliedsländer ins Wanken geraten sollte, würde dies negative Externalitäten auf die anderen EU-Länder, aber auch auf die Weltwirtschaft ausüben. Die Stabilisierung des Euro kann aber nur gelingen, wenn das Problem der Überschuldung der Mitgliedsstaaten gelöst wird.
Die Frage einer internationalen Konkursordnung für Staaten als einer möglichen Option zur Lösung dieses Problems ist bisher allerdings in der Literatur nur sehr wenig diskutiert worden (vgl. etwa Rogoff und Zettelmeyer 2002 oder Shleifer 2003), obwohl das Problem der staatlichen Überschuldungsneigung ja schon seit Jahrhunderten bekannt ist, wie der Verweis auf Wagners Gesetz dokumentiert. In den europäischen Verträgen und erst Recht in der Politik der europäischen Institutionen existieren keinerlei Hinweise, wie mit insolventen Staaten zu verfahren ist. Dies ist verwunderlich, denn in der EU besteht üblicherweise eine Neigung, jedes Detail zu klären bis hin zum Neigungswinkel der Euro-Gurke, der erst 2008 durch die EU-Agrarkommissarin Boel abgeschafft wurde (o.V. 2008). Zwar besteht im Lissabon-Vertrag der Verweis auf die no bail-out Klausel und der Zwang zur Einhaltung der Konvergenzkriterien. Allerdings scheint es so zu sein, dass das Prinzip Hoffnung und der Glaube an die unendliche Liquidität internationaler Organisationen die Notwendigkeit ersetzen, über eine fundamentale Ordnungsfrage nachzudenken: Was passiert, wenn ein Mitgliedsland der EU tatsächlich in Konkurs geht? Es drängt sich beinahe der Eindruck auf, man wolle bewusst keine Insolvenzordnung haben, um größtmögliche diskretionäre Handlungsspielräume für den IWF und andere internationale Organisationen zu schaffen.
In der vorliegenden Untersuchung werden zunächst die Ursachen und Folgen staatlicher Insolvenz analysiert (Kap. II). Anschließend werden die Auswege aus der gegenwärtigen europäischen Vertrauens- und Schuldenkrise geprüft und bewertet (Kap. III). Da keine Lösung ohne massive Kosten realisierbar ist, wird die Notwendigkeit einer Insolvenzordnung für Staaten ordnungspolitisch begründet (Kap. IV). Im Folgenden werden der Ordnungsrahmen mit Zielen und Gestaltungsprinzipien einer Insolvenzordnung für Staaten entwickelt (Kap. V) und die wichtigsten Elemente skizziert (Kap. VI). Im Anschluss daran werden die Folgen für Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik diskutiert (Kap. VII), bevor die Ergebnisse noch einmal zusammengefasst werden (Kap. VIII).
II. Ursachen und Folgen von staatlichen Insolvenzen
Unternehmen geraten in die Insolvenz, weil sie falsche Investitionen tätigen oder ihre Konkurrenzfähigkeit verlieren. Treffen diese Gründe auch für Staaten zu?
Staaten können wegen der Möglichkeit, auf die Steuerkraft ihrer Bürger zurückzugreifen, prinzipiell nicht zahlungsunfähig werden. Staatsverschuldung im Inneren kann durch entsprechende Steuererhöhungen beseitigt werden. Macht der Staat andererseits einen Schuldenschnitt bei seinen inländischen Bürgern, so ist das de facto eine einmalige Steuer, die nur die Bürger trifft, welche dem Staat Geld geliehen haben.
Anders verhält sich das bei der Verschuldung im Ausland. Diese Schulden kann ein Staat nur abtragen, indem er auf Erträge des inländischen Wirtschaftens zugunsten der ausländischen Gläubiger verzichtet. Überschuldet ist ein Staat gegenüber dem Ausland, wenn die Erträge der inländischen Wirtschaft und das Steueraufkommen nicht mehr ausreichen, um die Verpflichtungen gegenüber dem Ausland abzutragen.
Für die Einschätzung der Zahlungsfähigkeit eines Landes ist ebenfalls entscheidend, für was die Auslandskredite verwendet werden. Wenn investive Zwecke mit entsprechenden Erträgen verfolgt werden, ist eine bessere Bewertung gerechtfertigt als bei rein konsumtiver Verwendung, etwa zum Ausgleich von Haushaltslöchern. Es geht hier also um die Frage der „inneren Aufbringung des Kapitaldienstes“. So einfach diese theoretische Unterscheidung klingt, so schwer ist es in der Praxis zu bestimmen, ab welchem Punkt ein Land gegenüber dem Ausland zahlungsunfähig ist. Bei den Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Ausland ist auch die Denomination der Kredite zu bedenken. Lauten die Auslandskredite auf Fremdwährung, kann sich bei der Abwertung der Währung des Schuldnerlandes ein schwer vorhersehbarer Multiplikator-Effekt ergeben, weil sich der Realwert der Verschuldung erhöht. Dieses Problem stellt sich im Gläubiger-Schuldner-Verhältnis allerdings in einer Währungsunion wie der Eurozone nicht.
Zu beachten ist auch die sog. Transferbegabung der Schuldnerländer: Es gilt der Grundsatz, dass es ohne Gläubiger keine Schuldner geben kann, d.h. dass jede Kreditbeziehung zweiseitig ist und in der Regel auf der Basis einer freiwilligen Kreditvergabe durch einen Gläubiger erfolgt. Bei Kreditbeziehungen mit dem Ausland ist auf Gläubigerseite zu beachten, dass deren Engagement nicht vorhersehbar in die Kollektivhaftung übernommen werden darf. Genau auf diesen Punkt haben die Gläubiger Griechenlands gesetzt, die noch im Januar 2010 mit 6 Prozent verzinste Anleihen kauften in der Gewissheit, eine Geldanlage mit kostenlosem Vollkaskoschutz erworben zu haben.
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen lassen sich verschiedene Ursachen für eine staatliche Insolvenz ausmachen: Katastrophen, fehlerhafte Investitionen der Kreditnehmer und polit-ökonomische Ursachen. Naturkatastrophen, Unglücke oder andere unvorhersehbare Ereignisse, die außerhalb des staatlichen Einflusses liegen, können auch ein wohlgeordnetes Staatswesen an den Abgrund drängen – man denke etwa an die jüngsten Auswirkungen der Reaktorkatastrophe von Fukushima in Japan. Werden hierdurch der Produktionsapparat oder die Infrastruktur zerstört, so ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Staates – und damit seine Fähigkeit, Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland zu zahlen – gestört.
Missglückte Investitionen können Unternehmen, aber auch Staaten in Zahlungsschwierigkeiten bringen. Wenn ein Staat sich für Investitionsprojekte verschuldet, deren Erfolg in Form eines steigenden Sozialproduktes und damit steigender Steuereinnahmen ausbleibt, so ist die Rückzahlung dieser Kredite fraglich. Dabei ist dieses Investitionsrisiko nicht alleine auf den Staatsapparat beschränkt: Erweisen sich zu viele private Investitionen als verfehlt, so sinkt die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Steuerkraft. Bleiben die Staatsausgaben unverändert oder steigen sogar, bedarf es zur Abwendung einer Insolvenz der Kreditaufnahme. Tritt der Staat in größerem Ausmaß für die Verluste aus privaten Anlageentscheidungen ein, kann aus einer Unternehmens- eine Staatsinsolvenz entstehen, wie im Falle der irischen Bankenkrise.
Eine Staatsinsolvenz kann also aus wirtschaftlich verfehlten Investitionen ohne hinreichende privatwirtschaftliche Haftungsgrundlage entstehen. Unter den Bedingungen einer vorsorglichen marktwirtschaftlichen Ordnungspolitik ist dieser Fall ziemlich unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist dagegen der Fall staatlich geförderter und gelenkter Investitionen, die eine Gefahr für die Solidität der Staatsfinanzen darstellen können. Je mehr die Anreize der Politik auf einen speziellen Investitionszweck zielen, umso größer wird das damit verursachte Klumpenrisiko der Anlagen. Ein Beispiel ist die amerikanische Politik der Förderung des Wohnungseigentums in breiten Schichten der Bevölkerung, die als eine der Ursachen der amerikanischen Immobilienkrise und der sich daran anschließenden Finanzkrise gilt.
Eine andere Ursache kann in einer zu expansiven Geldpolitik, in marktwidrigen Wechselkursen oder in einer Währungsunion mit unzureichender budgetärer und monetärer Disziplin der Mitgliedsländer liegen. Ist die Zeit des billigen Geldes und der zügellosen staatlichen Verschuldung zu Ende, so zeigt sich, dass die damit finanzierten Investitionen bei höheren Zinsen unrentabel sind und auf dem Treibsand einer falschen Geld- und Budgetpolitik eine schwere volkswirtschaftliche Belastung darstellen. Dieser Fall ist zu berücksichtigen, wenn über eine Lösung des Insolvenzproblems nachgedacht wird.
Die wichtigste Ursache einer staatlichen Überschuldung ist politischer Natur, wenn etwa höhere Sozialleistungen ohne Steuererhöhungen versprochen werden, um die Chancen auf dem Wählerstimmenmarkt zu verbessern. Das Verlockende daran ist, dass die Vorteile aus der Staatsverschuldung direkt bestimmten Personengruppen zurechenbar sind, die Kosten der Verschuldung dagegen der Allgemeinheit zu Last fallen. Die Public Choice-Lehre hat diese Hypothese seit den Arbeiten von Downs (1968) und Niskanen (1971) theoretisch spezifiziert und empirisch untermauert. Demzufolge haben vor allem „unbeschränkte Demokratien“ (F. A. von Hayek) einen strukturellen Hang zu mehr Staatsverschuldung, um vor allem Sozialprogramme zu finanzieren. Je weniger diese investiven Charakter haben, umso größer wird das anschließende Schuldenproblem. Es erwächst aus der Tatsache, dass zu große Teile des Einkommens konsumiert statt investiert werden, und die Ursache dafür ist politischer Natur (vgl. Beck, Prinz 2012).
Die Folgen eines daraus hervorgehenden Staatsbankrotts sind weitreichend: Aktuelle Studien zeigen, dass ein Staatsbankrott das Wachstum des Sozialprodukts des Landes um 0,5 bis zwei Prozentpunkte senkt. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass dieser Effekt recht kurzfristig ist und sich mehr oder weniger auf das erste Jahr des Staatsbankrotts beschränkt – schon zwei, drei Jahre später lässt sich kein spürbarer Effekt mehr empirisch nachweisen (Borensztein, Panizza 2008, S. 8).
Eine weitere Folge eines Staatsbankrottes sind höhere Zinskosten für die betreffenden Staaten und schlechtere Bonitätsnoten von den Rating-Agenturen (zu den Rating-Agenturen vgl. ausführlich Beck, Wienert 2009), welche die Zinskosten für neue Schulden zusätzlich erhöhen. Schätzungen zufolge muss ein Land nach einem Staatsbankrott im Jahr der Staatspleite einen Zinssatz zahlen, der um vier Prozentpunkte über den marktüblichen Zinsen liegt. Allerdings ist unklar, wie nachhaltig dieser Effekt ist; es finden sich Belege dafür, dass dieser Effekt eher kurzfristiger Natur ist (Borensztein, Panizza 2008, S. 14). Für Schwellenländer finden sich Hinweise, dass Staaten, die in der Vergangenheit zahlungsunfähig waren, von den Rating-Agenturen über längere Frist eine geringere Bonitätsnote erhielten als Staaten mit ähnlicher Finanzstärke (Reinhart, Rogoff, Savastano 2003). Auch im Inland steigen die Zinsen nach einem Staatsbankrott langfristig (Kinoshita 2006; Ardagna, Caselli, Lane 2006).
Die Zahlungsunfähigkeit eines Staates geht zumeist auch mit einer Bankenkrise oder einer Währungskrise einher. Eine Staatspleite in Kombination mit einer Bankenkrise bringt im Schnitt die höchsten Kosten für eine Volkswirtschaft mit sich; allenfalls eine dreifache Krise (Insolvenz, Bankenkrise, Währungskrise) ist noch teurer (Paoli, Hoggarth, Saporta 2006). Dabei steigt das Risiko einer Bankenkrise um bis zu elf Prozentpunkte, wenn ein Land zahlungsunfähig wird. Eine solche Krise ist vor allem dann wahrscheinlich, wenn die inländischen Banken dem Staat viel Geld geliehen haben, das dieser nun nicht zurückzahlen kann.
Bereits im Vorfeld der Zahlungsunfähigkeit kann es durch Erwartungseffekte zu einer Abwertung der inländischen Währung kommen. Die Abwertung wird umso stärker ausfallen, umso höher die Verschuldung im Ausland ist. Verstärkt wird diese Abwertungstendenz durch eine Zunahme der Kapitalflucht, wenn die Anleger die Abwertung der heimischen Währung antizipieren. Vor allem im Zusammenhang mit festen Wechselkursen kommt es zu einer Währungskrise, an deren Ende eine drastische Abwertung der inländischen Währung steht. Sind die Schulden des Staates in ausländischer Währung denominiert, so steigt die Schuldenlast in inländischer Währung.
Auch die Finanzierung des Außenhandels kann durch eine Staatsinsolvenz negativ beeinflusst werden. Wie stark eine Staatspleite den Außenhandel beeinträchtigt, ist quantitativ schwer zu prognostizieren: Für Länder, die Ihre Schulden im Rahmen des Pariser Clubs umgeschuldet haben, finden sich Hinweise, dass der Handel solcher Staaten mit ihren Gläubigern bis zu 15 Jahre nach der Zahlungsunfähigkeit davon beeinträchtigt worden ist, was sich auf ein Minus von bis zu acht Prozent pro Jahr kumuliert (Rose 2005, S. 205). Andere Studien hingegen finden, dass der negative Effekt eines Staatsbankrotts auf die Exporte eher kurzlebiger Natur ist (Borensztein, Panizza 2006, S. 26f.). Dies hängt entscheidend von der Art der handelbaren Güter und von der Außenhandelsstruktur eines Landes ab.
Ein Staatsbankrott hat auch politische Folgen: Schätzungen gehen davon aus, dass die Zahl der Wählerstimmen für die Regierung, die den Konkurs verkündet hat, um etwa 16 Prozent sinkt; in der Hälfte aller Fälle war spätestens das zweite Jahr nach der Insolvenz Endstation für den jeweiligen Regierungschef, der das Insolvenzverfahren eingeleitet hat (vgl. Borensztein, Panizza 2008, S. 20f.). Wenn dieses Ergebnis tatsächlich stimmt, so kann man verstehen, warum konkursbedrohte Regierungen wie Griechenland, Irland oder Portugal zu einer Konkursverschleppung neigen.
Eine zusätzliche Problemdimension erhält eine Staatsinsolvenz, je mehr der betreffende Staat über Handel, Faktorwanderungen und Finanzmärkte in die internationale Staatengemeinschaft eingebunden ist. Je enger diese Bindungen sind, um so größer ist die Gefahr, dass die Insolvenz eines Landes auch Auswirkungen für weitere, ausländische Staaten hat. Dabei lassen sich verschiedene Transmissionskanäle feststellen. Ein direkter Ansteckungseffekt erfolgt über das internationale Bankensystem: Wenn die Gläubiger der Kredite, die der insolvente Staat nicht mehr zurückzahlen kann, ausländische Banken sind, so kann eine Insolvenz das private Bankensystem anderer Staaten in Gefahr bringen. Dies gilt umso mehr, je mehr sich die Kredite auf einzelne Institute oder Länder konzentrieren und je geringer der Kapitalpuffer der betroffenen Institute ohnehin ist. Und je enger die Verbindungen zu anderen Instituten sind – beispielsweise über den Interbankenmarkt, umso größer ist die Gefahr von Ansteckungseffekten. Beispielhaft ist hierfür die griechische Schuldenkrise, die viele europäische Institute, ohnehin noch angeschlagen von der ersten Finanzkrise 2008, in Bedrängnis brachte.
Sehr komplex und vielschichtig sind die Ansteckungseffekte über die Geldpolitik und die Währungsmärkte: Geht die Insolvenz eines Staates mit hohen Inflationsraten einher (was oft der Fall ist), so kann es zu einer Kapitalflucht in Drittstaaten kommen; je nach Wechselkursregime, Offenheitsgrad und inländischer Geldpolitik des Drittlandes kann es hier ebenfalls zu Problemen kommen. Ein weiterer Ansteckungseffekt läuft über den zwischenstaatlichen Handel: Ein Rückgang des Außenhandels und eine Abwertung der Währung eines wichtigen Handelspartners kann bei den wichtigsten Handelspartnern zu einem Einbruch des Exportgeschäfts und damit zu Wachstumseinbußen führen.
Eher psychologischer Natur sind Ansteckungseffekte, die über die Erwartungen von Finanzmärkten und Kreditgebern laufen: Gerät ein Staat in Finanznöte, so erhöht sich schlagartig das Risikobewusstsein der Kapitalmärkte und weitere Staaten werden auf den Prüfstand gestellt. Das kann dazu führen, dass Staaten, bei denen man ähnliche Probleme vermutet, schwerer an neues Kapital kommen – Kredite werden nicht verlängert, höhere Risikoprämien gefordert, es kommt zu Kapitalabflüssen. Psychologische Ansteckungseffekte können im schlimmsten Fall zu einem Zusammenbruch der Staatsfinanzen führen. Diese Gefahr besteht aktuell offensichtlich im Falle Spaniens.
Eine zusätzliche Dimension erhält ein Staatsbankrott, wenn der betreffende Staat Mitglied einer Währungsunion ist, in der eine strenge budgetäre und monetäre Disziplin herrscht. Ein entscheidender Unterschied zu den obigen Überlegungen besteht darin, dass in diesem Fall die nationale Geldpolitik als vermeintlicher Rettungsanker nicht mehr zur Verfügung steht. Eine Beseitigung zumindest der inländischen Schulden über eine Besteuerung durch Inflation scheidet damit aus; auch eine Abwertung der inländischen Währung ist keine Option mehr für die Politik. Abgesehen von diesen beiden Punkten bestehen keine ökonomischen Unterschiede zwischen einem Staatsbankrott eines souveränen Staates und der Insolvenz eines Mitglieds einer Währungsunion. Allerdings ist da noch die politische Flanke: Der Bankrott eines Mitglieds einer solchen Gemeinschaft kann als starkes politisches Signal gedeutet werden, der die Währungsgemeinschaft dazu zwingt, zur Hilfe zu eilen, um die Solidarität der Gemeinschaft zu demonstrieren. In diesem Fall muss man damit rechnen, dass durch die Nationalstaaten auf die Geldpolitik Druck ausgeübt wird, um insolventen Mitgliedsländern beizuspringen. Zudem entsteht politischer Druck auf die Finanzpolitik, den betreffenden Staaten zu helfen.
Diese Folgen einer Staatsinsolvenz für andere Staaten kann man – mit gebotener Vorsicht – als negative externe Effekte auslegen, die eine staatliche Intervention rechtfertigen würden. Warum sollte etwa Slowenien oder Estland, die in den letzten 20 Jahren beachtliche stabilitätspolitische Erfolge erzielen konnten, für das griechische Haushaltsproblem mit in die Haftung genommen werden? Die potenzielle Gefahr, die von einem Staatsbankrott auf andere Staaten mit vergleichsweise guten stabilitätspolitischen Erfolgen ausgeht, kann staatliche Bemühungen rechtfertigen, dieses Thema auf internationaler politischer Ebene zu behandeln. Allerdings ist dieses Argument mit einem großen politischen Risiko versehen, denn nicht wenige Politiker könnten das Externalitäten-Argument als Freibrief für staatliche Intervention interpretieren.
Schwierig zu bestimmen ist, ab welcher Schwelle der Staatsverschuldung man mit einem Staatsbankrott und den hier vorgestellten Folgen rechnen muss. In der Literatur findet sich oft die Marke von 90 Prozent für den Schuldenstand, ab der die negativen Folgen der Staatsverschuldung für das Wachstum ausgeprägter werden (hierzu siehe Kumar, Woo 2010; Checherita, Rothe 2010) und die Schuldendynamik zunehmend nicht-linear verläuft.
Es gibt Versuche, fiskalische Schwellen zu ermitteln, ab denen die Schuldendynamik eines Landes explosiv und unberechenbar wird. Diese Versuche sind jedoch teilweise methodisch äußerst fraglich und liefern nur wenig neue Erkenntnisse, die nicht auch schon im Wagnerschen Gesetz oder in der Ricardianischen Äquivalenz angelegt wären. Für die Bundesrepublik Deutschland vermuten Ostry und andere (2010) die fiskalische Schwelle bei 155 Prozent. Bei einem Schuldenstand von derzeit 73,2 Prozent des BIP liegen damit noch ca. 76 Prozentpunkte Staatsverschuldung zwischen der tatsächlichen Verschuldung der Deutschen und dem kritischen Schwellenwert. Für Italien und Japan ist der fiskalische Spielraum bei Null, Griechenland hat theoretisch einen fiskalischen Spielraum von rund 38 Prozentpunkten, die Vereinigten Staaten haben 74 Prozentpunkte Luft, bei den Briten sind es 91 Prozentpunkte.
Die empirischen Aussagen von Ostry sind jedoch mit äußerster Vorsicht zu verwenden und kaum für eine realistische Politikberatung zu verwenden: Die Politikempfehlung liefe gleichsam auf ein „Weiter so!“ hinaus. Für Deutschland würde dies etwa bedeuten, dass man quasi noch einmal den gleichen Schuldenberg zusätzlich anhäufen dürfte. Es ist weder theoretisch denkbar noch praktisch vorstellbar, dass dies funktionieren könnte, denn über den Zinseffekt wäre in kürzester Zeit der gesamte Bundeshaushalt für Schuldendienste aufgezehrt. Dann wäre auch die neu eingeführte Schuldenbremse wirkungslos, nutzlos und letztlich überflüssig: Sicherlich ein wissenschaftlicher Rat, den mancher in der Politik gerne hören würde.
Jede quantitative Festlegung von Höchstgrenzen ist wissenschaftlich und politisch umstritten – man denke nur an die bisweilen kontroverse Diskussion um quantitative Festlegung der Maastricht-Kriterien. Eines jedoch scheint gegenwärtig klar: Für manche Staaten ist es nicht mehr weit bis zur finanzpolitischen Kernschmelze, in Griechenland ist sie vermutlich bereits erfolgt. Und sicherlich wird der Konkurs einzelner Staaten auch negative Auswirkungen auf solidere Staaten haben, die jetzt noch kleinere finanzpolitische Spielräume haben. Wenn Österreich, die Niederlande und Deutschland in die Solidarhaftung der Transferunion gezwungen werden und reales Geld fließen (muss), könnte auch in diesen Ländern sehr rasch der Haushaltsnotstand eintreten.
III. Auswege aus der europäischen Staatsschuldenkrise
Die theoretischen und historischen Überlegungen zu staatlichen Insolvenzen lassen sich nun mit der spezifischen Situation in Europa verbinden. Was ist in der gegenwärtigen Situation ordnungspolitisch ratsam?
Die europäische Schuldenkrise weist Züge einer griechischen Tragödie auf – und das nicht nur, weil Griechenland einer der Protagonisten ist. Aus der gegenwärtigen Situation, dass ein Land de facto schon in Konkurs ist und eine Reihe von weiteren Staaten an der Schwelle der Zahlungsunfähigkeit wandeln, gibt es keinen einfachen Ausweg mehr. Erst recht ist festzustellen, dass es keine schmerzfreie Lösung gibt. Der Instrumentenkasten der Wirtschaftspolitik bietet für die gegenwärtige Situation folgende Optionen: Inflation, Währungsabwertung, Austritt der betroffenen Länder aus der Währungsunion, bail out der verschuldeten Staaten, massive Sparmaßnahmen oder schließlich der offene Staatsbankrott. Weitere Optionen existieren nicht. Welche Auswirkungen hätten die einzelnen Maßnahmen?
1. Inflation
Historisch gesehen haben viele überschuldete Länder den Ausweg der Inflation gewählt (vgl. Reinhart und Rogoff 2009). Die Europäische Zentralbank könnte systematisch und massiv die Geldmenge ausweiten und dadurch die Inflationsrate erhöhen. Dies würde zu einer realen Entwertung der Schulden führen; de facto ist Inflation eine undifferenzierte Steuer, welche die Gläubiger des Staates zahlen müssen. Die Zentralbank könnte auch Anleihen überschuldeter Staaten aufkaufen und diese direkt monetär alimentieren. Diese Strategie wurde prinzipiell von der Deutschen Reichsbank vor und während des Zweiten Weltkrieges verfolgt. Wenn die Regierung den Realwert der Schulden bis zum gewünschten Punkt gesenkt hat, könnte sie wieder zu einer Politik der Inflationssenkung umschwenken – wenn es dann noch geht und sich die Inflationserwartungen wieder einfangen lassen. Sie könnte allerdings auch die Inflationspolitik bis zur Hyperinflation weitertreiben und damit einen vollständigen währungs- und finanzpolitischen Neuanfang versuchen. Auch in den jüngsten Debatten nach der Finanzkrise wurde von prominenter Seite eine höhere Inflationsrate als Lösung gefordert (Blanchard, Dell’Ariccia, Mauro 2010).
Dennoch: Die Inflationsalternative klingt für Europa nicht nur auf den ersten Blick völlig abwegig. Gerade vor dem Hintergrund der deutschen Erfahrungen ist nicht vorstellbar, dass die Öffentlichkeit eine Enteignung ihrer Sparguthaben und Vermögenswerte ohne Widerstand hinnehmen würde. Darüber hinaus spricht ein technisches Argument dagegen, dass über Inflation die staatlichen Schuldenprobleme zu lösen sind: Eine überraschende Inflation kann allenfalls den aktuellen Schuldenberg inflationieren, jegliche weitere Schuldenaufnahme würde dann nur unter den Vorzeichen höherer Nominal- beziehungsweise mindestens konstanter Realzinsen stattfinden. Je kürzer also die Duration der gesamten Staatsverschuldung eines Landes ist, um so geringer ist der Lösungsbeitrag der Inflation zum Schuldenproblem; da mit jedem debt-roll-over neue Schulden zu höheren Zinsen aufgenommen werden müssen. Lediglich immer neue Runden überraschender Inflation – also eine Inflationsspirale – wären dann in Hinblick auf das Schuldenproblem wirksam. Angesichts der damit verbundenen Folgen keine ernsthafte Option.
Zudem scheint das institutionelle Gefüge der Deutschen Bundesbank und auch der Europäischen Zentralbank stark genug zu sein, um diesem politischen Ansinnen einzelner Staaten nicht nachzugeben. Der Ankauf von Staatsanleihen stellt nach gültigem Gesetz ohnehin einen Vertragsbruch dar, wenngleich die EZB aktuell mit dem Ankauf von Staatspapieren der PIIGS-Staaten aus den Portfolios von Privatbanken seit dem Sommer 2010 offensichtlich auf sehr dünnem Eis wandelt. Einem dauerhaften Ankauf von Staatsanleihen hoch verschuldeter Länder ist jedenfalls entschieden zu widersprechen.
Eine europäische Inflationspolitik würde zu einer massiven Abwertung des Euro führen mit katastrophalen Folgen für die Euro-Staaten, aber auch für die Weltwirtschaft, die zunehmend auf den Euro als Reserve- und Transaktionswährung setzt. Eine „Inflationsüberraschung“, wie sie beim Friedmanschen Helikopter-Geld möglich wäre, kann in einer medial geprägten und völlig vernetzten internationalen Finanzwelt ebenfalls nicht unbemerkt bleiben. Jede noch so moderate Geldmengenausweitung oder Zinssatzänderung wird von den Finanzmärkten sorgfältig beobachtet: Von Geldillusion kann man realistischer weise nicht ausgehen.
Allerdings scheint die Federal Reserve Bank in den USA zumindest derzeit mit einer moderaten Inflationspolitik von etwa vier Prozent zu liebäugeln. Wenn dem so wäre, könnte Europa in der Realität zumindest indirekt von Inflationspolitik betroffen sein, nämlich der amerikanischen. Verlierer einer solchen Politik wären in jedem Fall die Gläubiger, die Sparer und die Steuerzahler. Gewinner einer solchen Politik wären die Regierungen, die sich ihrer Schulden entledigen könnten. Allerdings ist – wie bereits angesprochen – kaum vorstellbar, dass eine solche Regierung noch einmal eine demokratische Wahl gewinnen könnte (vgl. Borensztein und Panizza 2008), was die Attraktivität dieser Option zumindest für europäische Staaten weiter reduziert. Die Abwahl der portugiesischen Regierung im März 2011 nach der Ankündigung der Sparmaßnahmen zeigt, was auf die europäischen Regierungen zukommt, wenn sich die Verschuldungskrise weiter zuspitzt.
2. Währungsabwertung
Ein überschuldeter Staat mit Leistungsbilanzdefiziten kann seine Währung abwerten und dadurch Importe reduzieren und Exporte stimulieren. Er entlastet hierdurch seine defizitäre Leistungsbilanz und kann ggf. durch Exportsteigerungen neue Einnahmen erzielen. Historisch gab es immer traditionelle Abwertungsländer, die diese Option nutzten. Auch im Europäischen Währungssystem (EWS) hat es seit seiner Einführung 1978 bis in die jüngste Zeit zahlreiche Wechselkursanpassungen (realignments) gegeben. Hätte Griechenland seine alte Währung behalten, wäre dies eine sehr naheliegende Option. Die praktische Möglichkeit der Währungsabwertung ist auch die Erklärung, warum der Beinahe-Konkurs von Ungarn und Lettland 2009 so geräuschlos vom IWF abgewickelt werden konnte. Es ist wirtschaftspolitisch eben ein anderer Sachverhalt, ob ein Staat als singulärer Einzelfall auftritt oder ob er Mitglied einer Währungsunion ist und sein Konkurs andere Mitglieder der Währungsunion direkt betrifft.
Die strategische Wechselkurspolitik ist ordnungspolitisch höchstens als letzter Ausweg zu betrachten. Ein Land, das seine Strukturprobleme nicht in den Griff bekommt und permanent Wechselkursmanipulationen benötigt, um den Zwängen der Leistungsbilanz zu entrinnen, kann keine Glaubwürdigkeit gewinnen. Es kann höchstens auf Zeit spielen. Eine Manipulation der nationalen Währung ist – zumindest im Falle eines Leistungsbilanzdefizites – nur temporär möglich. Spätestens wenn die nationalen Devisenreserven zur Neige gehen, erfolgt zumeist zwangsweise die schlagartige Freigabe des Kurses – es sei denn, ein Staat versucht mit Devisenbewirtschaftung sein Glück.
Zudem ist festzuhalten, dass diese Option in einer Währungsunion nicht mehr existiert, denn eine Währungsunion ist prinzipiell ein System fester Wechselkurse, aber ohne Anpassungsmöglichkeiten. Die monetäre Autorität liegt nicht mehr bei der nationalen Notenbank, sondern allein bei der Europäischen Zentralbank, die für den Wechselkurs verantwortlich ist. Damit ist Griechenland quasi eingesperrt in einem monetären Korsett, dem es nicht entrinnen kann. Seidel (2009) fragt nicht umsonst, ob die Mitgliedschaft in der Währungsunion (EWU) für schwache Länder eher wie ein Schutzschild wirkt oder aber zur Falle wird, der sie nicht entrinnen können. Wenn ein Land wie Griechenland permanente Leistungsbilanzdefizite produziert und über keine nennenswerten international handelbare Güter verfügt, liegt die Vermutung nahe, dass die EWU eher zur Falle wird. Aus diesem Blickwinkel wäre beispielsweise Polen, Tschechien oder Ungarn zu empfehlen, noch möglichst lange mit dem Beitritt zur Währungsunion zu warten, um für den Fall einer dramatischen wirtschaftspolitischen Krise noch eine Ausweichmöglichkeit zu haben.
3. Austritt aus der EWU
Die dritte denkbare Option in der europäischen Vertrauenskrise wäre es, die konkursbedrohten Länder wie Griechenland aus der Währungsunion auszuschließen und damit auf den Status zurückzustufen, den jetzt beispielsweise Großbritannien, Schweden oder Dänemark haben, nämlich voll anerkanntes Mitglied der EU zu sein, aber zugleich die eigene Währung beizubehalten. Eine solche Position wird beispielsweise von Hankel, Starbatty und anderen vertreten, die schon sehr früh in ihren Arbeiten (2001) davor gewarnt haben, dass die Währungsunion zur Transferunion mutieren könnte. Diese Autoren plädieren auch ganz offen für den Ausschluss von Ländern aus der Eurozone, wenn sie vorsätzlich und wiederholt die EU-Verträge und die Maastricht-Kriterien verletzt haben. Eine ähnlich harte Position wird auch von Rogoff (2011) vertreten, der mit der Theorie optimaler Währungsräume argumentiert und zu dem Schluss kommt: „Einige Länder sollten eine Euro-Auszeit nehmen“.
Die auf den ersten Blick einfachste Lösung erweist sich bei genauerer Betrachtung als Katastrophenlösung für Griechenland, aber auch für die Währungsunion als Ganzes. Eine Wiedereinführung der Drachme könnte kaum gelingen, denn der Kurs würde vermutlich im Moment seiner Einführung ins Bodenlose fallen. Außerdem dürfte kaum ein Grieche bereit sein, seine Barbestände in Euro freiwillig in die neue (alte) Währung umzutauschen, stattdessen würde es zu einer Kapitalflucht dramatischen Ausmaßes kommen, die auch die Destinationsländer – vermutlich vor allem Deutschland – in Bedrängnis bringen dürfte. Ein Austritt Griechenlands aus der Währungsunion müsste somit überraschend in einer dramatischen Nacht- und Nebelaktion erfolgen, ein schwer vorstellbares Szenario. Eine neue Drachme hätte zudem mit dem Umstand zu kämpfen, dass der heimatlichen Währung von der ersten Minute an im eigenen Land eine übermächtige Parallelwährung entgegenstünde. Ein solches Experiment hat es in der Wirtschafts- und Währungsgeschichte bisher noch nicht gegeben.
Ferner ist zu berücksichtigen, dass sich Griechenland in den vergangenen Jahren seit der Einführung des Euro 2003 ausschließlich in Euro verschuldet hat. Eine Wiedereinführung der Drachme würde also den Realwert der in Euro denominierten Schulden vervielfachen: Die unmittelbare Zahlungsunfähigkeit wäre die Folge. Ein Austritt der Griechen aus der Währungsunion wäre also zwingend an eine Umschuldung gekoppelt.
Außerdem liegt die Sondersituation vor, dass Griechenland zwar finanziell Schiffbruch erlitten hat, davon abgesehen aber seit 1981 ganz normales Mitglied der Europäischen Gemeinschaften bzw. der Union ist. Ein Fortbestehen der EU-Mitgliedschaft bei gleichzeitigem Ausschluss aus der Währungsunion würde vermutlich zu einem massenhaften Exodus der Griechen führen, die ja nach wie vor noch die Privilegien des Binnenmarktes nutzen dürfen. Es ist nicht vorstellbar, mit welchen wirtschaftspolitischen (oder militärischen) Mitteln die Kapitalflucht aus dem Land gestoppt werden könnte. Die drohende Kapitalflucht wäre angesichts des gemeinsamen Binnenmarktes kaum aufzuhalten. Ein Austritt der Griechen wäre sehr wahrscheinlich mit einer zumindest vorübergehenden Suspendierung der vier Grundfreiheiten verbunden.
4. Der bail out
Die vollständige oder teilweise Übernahme der Schulden bzw. die Gewährung von Gemeinschaftskrediten oder Zinsvergünstigungen ist die vierte wirtschaftspolitische Option. Zugegeben: Es ist die Option, vor der die Gründungsväter der Währungsunion die meiste Angst hatten und vor der die Euroskeptiker immer gewarnt haben (vgl. dazu ausführlich Issing 2010).
Bei der Übernahme der Schulden sind viele Variationen denkbar und es kann mit Instrumenten gearbeitet werden, die für die Öffentlichkeit praktisch nicht mehr nachvollziehbar sind. So können einem hoch verschuldeten Land die Schulden erlassen werden oder es können Privatbanken dazu animiert werden, die Staatspapiere des betroffenen Landes zu kaufen – selbstverständlich mit Garantiezusagen der solideren Länder oder internationaler Organisationen. Ob solche großzügigen Geschenke mit spezifischen Auflagen verbunden sein sollten (etwa bezüglich der zukünftigen Haushaltspolitik), wäre zu prüfen. Denkbar wäre es auch, wie von Jean-Claude Juncker gefordert, Euro-Bonds zu begeben, die die Zinszahlungen der schwächeren Länder mit den Zinszahlungen der stärkeren Länder verknüpfen (vgl. dazu bspw. Delpla und von Weizäcker 2011). Griechenland könnte sich dann am Kapitalmarkt quasi zu den Zinssätzen etwa von Holland oder Österreich refinanzieren. De facto laufen sämtliche Details der bisherigen Rettungspakete auf ein bail out hinaus.
Ordnungspolitisch ist festzuhalten, dass eine bail out-Politik zu massiven Fehlanreizen führt: Solide Staaten haften für finanzpolitisch unsolide Schuldenmacher. Die sehr schwierigen Erfahrungen mit dem deutschen Länderfinanzausgleich, bei dem drei wirtschaftsstarke Nettozahler für alle Defizitländer haften, sollte eine dringende Warnung sein. Es kann in Europa sogar zu der Situation kommen, dass relativ ärmere Länder wie Slowenien, die eine beachtliche Stabilität aufweisen, für relativ reichere Länder wie Griechenland oder Irland haften müssen, die seit Jahren die finanzpolitische Kontrolle verloren haben. mit Blick auf die negativen Anreize eines bail out und die Grenzen der europäischen Solidarität ist die Ratio einer no bail out-Klausel gut nachvollziehbar.
Die no bail out-Klausel hat allerdings ein Glaubwürdigkeitsproblem, das aus der Geldpolitik bestens bekannt ist. Bei Vereinbarung der Klausel ist es strategisch angeraten, jedem Land für den Fall der Zuwiderhandlung mit Konkurs zu drohen. Wenn aber der Konkursfall tatsächlich eintritt, gilt es hauptsächlich, Schaden von den anderen Teilnehmerländern abzuwenden – das Pleiteland ist to big to fail. Im realen Konfliktfall kann die harte Lösung politisch nicht durchgesetzt werden. Das führt zu einem geradezu perversen Anreiz: Staaten neigen dazu, sich auch zukünftig übermäßig zu verschulden in dem festen Vertrauen, im Konkursfall gerettet zu werden. Außerdem haben die privaten Geschäftsbanken den Anreiz, mit den teilweise hochverzinslichen Staatsanleihen massiv zu spekulieren. Noch im Januar 2010, also wenige Wochen vor der Zahlungsunfähigkeit der Griechen, wurden griechische Anleihen zu 6 Prozent als echte Schnäppchen an den Märkten und in Vermögensverwaltungen angeboten.
Wirtschaftspolitisch führt die Schuldenübernahme unweigerlich von der Währungsunion in die Transferunion. Das ist politisch nicht mehr vermittelbar: Warum sollen einzelne Geberländer im eigenen Haushalt strikt sparen, gleichzeitig aber Rückstellungen in zweistelliger Milliardenhöhe planen, um konkursbedrohte Länder zu retten, die an ihrer Situation selbst schuld sind? Auch verfassungsrechtlich bestehen zumindest für Deutschland große Fragezeichen, ob solche Zahlungen überhaupt noch verfassungskonform sind, denn immerhin verlangt das Grundgesetz, dass Einnahmen und Ausgaben des Staates einer parlamentarischen Kontrolle bedürfen. Wenn dem deutschen Steuerzahler also Risiken aufgebürdet werden, die sich vollständig der Kontrolle der Parlamente entziehen, so könnte das Bundesverfassungsgericht die Notbremse ziehen. Eine europäische Transferunion jedenfalls scheint verfassungsrechtlich nicht gesichert. Sie macht auch politisch und ökonomisch keinen Sinn. Strapaziert man die Solidarität der europäischen Staaten zu stark, so kann dies sogar zu einem Verlust an Akzeptanz der Union, schlimmstenfalls zu einem Auseinanderbrechen führen.
5. Sparen und Haushaltskonsolidierung
Die Reduzierung der Staatsausgaben bis hin zu einem ausgeglichenen Haushalt wäre ordnungspolitisch eine zweckmäßige Alternative. Soll langfristig die Zinsbelastung aus der schon bestehenden Staatsschuld gesenkt werden, müssen sogar Budgetüberschüsse erzielt werden, die zweckgebunden für die Schuldenrückzahlung einzusetzen wären. Ein strikter Sparkurs könnte mit Hilfe des Rasenmäherprinzips durch die gleichmäßige lineare Beschneidung aller Ressorts erfolgen. Vieles spricht dafür, dass im demokratischen Prozess nur ein solcher Ansatz durchsetzungsfähig wäre – wenn überhaupt.
Bei der ordnungspolitischen Bewertung sind eine finanzwissenschaftliche, eine polit-ökonomische und eine praktische Perspektive zu unterscheiden. Finanzwissenschaftlich ist nach wie vor nichts gegen eine temporäre moderate Verschuldung von Staaten, Unternehmen und Privaten zu sagen, wenn damit ertragreiche Investitionen – etwa in Infrastruktur oder Bildung – finanziert werden. Und auch die (keynesianische) Idee, dass in Krisenzeiten durch staatliche Ausgabenprogramme gegengesteuert werden sollte, während in Boomzeiten der Staat mögliche Budgetüberschüsse erzielen kann, ist nicht grundsätzlich zu verwerfen. Aus finanzwissenschaftlicher Perspektive ist ein konjunkturunabhängiger Sparzwang bedenklich, weil er in Krisenzeiten pro-zyklisch und krisenverschärfend wirken kann.
Aus polit-ökonomischer Perspektive ist jedoch eine andere Bewertung vorzunehmen. Die Idee, dass sich demokratisch legitimierte Regierungen aus eigenen Stücken auf ausgeglichene Haushalte einigen, ist vor dem Hintergrund eigeninteressierter Politiker sehr optimistisch. Buchanan und Wagner (1977) haben dies genau auf den Punkt getroffen: Die Möglichkeit staatlicher Verschuldung bedeutet für den Politiker die Versuchung, Geld auszugeben, ohne besteuern zu müssen: „to spend without to tax“. Dieser Versuchung kann kein Politiker widerstehen, weshalb der Zwang zu einem ausgeglichenen Haushalt letztlich in allen EU-Mitgliedsstaaten verankert werden müsste.
Für die konkrete Problemlösung im aktuellen Fall in Griechenland ist jedoch Sparen keine erfolgversprechende Option. Griechenland hat bereits mit 300 Milliarden Euro eine derart hohe Staatsverschuldung in Relation zur eigenen Wirtschaftsleistung angehäuft, dass allein schon der Zinseffekt nicht mehr zu kontrollieren ist. Mit der Anhebung der Mehrwertsteuer und der Erhöhung der Alkohol-Steuern sind keine signifikanten Mehreinnahmen zu erzielen. Die Bevölkerung wird lediglich radikalisiert. In Griechenland hat quasi schon die finanzpolitische Kernschmelze eingesetzt.
In Deutschland könnte der finanzpolitische Kollaps noch vermieden werden, wenn die ordnungspolitisch begrüßenswerte Schuldenbremse ab 2014 Wirkung zeigen sollte. Insofern wäre Sparen und der Versuch der verfassungsrechtlich geschützten Haushaltskonsolidierung ein empfehlenswerter Weg. Das Einfrieren bzw. Abschmelzen der bestehenden Schulden könnte sich über einen sehr langen Zeitraum strecken. Allerdings können Sonderverpflichtungen wie etwa die Bürgschaften für konkursbedrohte Geschäftsbanken und Landesbanken jede Form der Haushaltskonsolidierung schnell zunichte machen. Und erst Recht ist es abzulehnen, wenn nationale Konsolidierungsbemühungen durch die Haftungsübernahme für marode europäische Staaten konterkariert werden.
6. Der Staatsbankrott
Die letzte und finale Option für die gegenwärtige Krise ist der Konkurs überschuldeter Staaten, unabhängig davon, ob diese Mitglied in der Währungsunion sind oder nicht. Bei einem Staatsbankrott wären die Schulden teilweise oder vollständig zu streichen. Private Zeichner von Staatstiteln, Banken und der Steuerzahler wären in der Haftung. Es könnte differenziert werden zwischen Binnenverschuldung und Außenverschuldung. Der Konkurs wäre eine realistische Lösung, die schnell wirkt und die den Tatsachen entspricht, also ehrlich ist.
Vor dem Hintergrund der hier diskutierten wirtschaftspolitischen Alternativen und der historischen Erfahrungen scheint der Konkurs einiger EU-Staaten kaum noch vermeidbar. Eine teilweise oder vollständige Streichung der Schulden – wie etwa im Londoner Abkommen von 1953 zur Lösung der Schulden des Deutschen Reiches – ermöglicht den überschuldeten Staaten einen Neuanfang. Allerdings birgt diese Strategie für den Fall Griechenlands schwerwiegende Gefahren; die Folgen eines Staatsbankrotts wurden bereits weiter oben erörtert. Die Bonität Griechenlands wäre vermutlich auf längere Zeit massiv gestört, die negativen Auswirkungen für den Außenhandel und die Finanzierungsmöglichkeiten an den Kapitalmärkten könnten sich sicherlich auf deutlich mehr als zehn Jahre strecken (vgl. Rose 2005).
Im Falle eines Konkurses ist auch nicht genau vorhersehbar, wie die griechische Bevölkerung reagieren würde. Kapitalflucht, Auswanderung, politischer Aufstand wären durchaus denkbare Optionen. Entscheidend wäre es sicherlich, dass die neue (alte) Regierung eine wirklich glaubwürdige Kursänderung durchführen und diese auch langfristig konstitutionell absichern würde.
Einer der Hauptgründe, warum Griechenland am Tropf der Rettungspakete gehalten wird, liegt in der Nicht-Kalkulierbarkeit des Ansteckungseffektes. Vermutlich ist, wie bereits oben diskutiert, vom schlechtesten Fall einer dreifachen Krise auszugehen, dass eine staatliche Finanzkrise mit einer Währungskrise und einer Bankenkrise zusammen auftritt. Griechische Anleihen werden primär von französischen Banken gehalten, spanische Anleihen primär von deutschen Banken (BIS 2011). Der Konkurs der Staaten würde unverzüglich zu Wertberichtigungen in dreistelliger Milliardenhöhe führen. Die privaten Banken müssten von den Regierungen ihrer Länder gerettet werden – und bei all den bisherigen Bürgschaften und Sicherungszusagen ist davon auszugehen, dass irgendwann auch einmal echtes Geld fließen muss. Ob die Staaten dazu überhaupt in der Lage sind (finanziell, politisch, verfassungsmäßig), ist fragwürdig.
Besonders kritisch ist festzuhalten, dass ein potentieller Konkurs der Problemstaaten ungeregelt ablaufen würde. Die jüngsten Erfahrungen mit den Beschlüssen über die Rettungspakete sind erschreckend. Riesige Summen wurden an einem Wochenende völlig außerhalb der Parlamente beschlossen und nachträglich mit Sachzwängen begründet. Es ist zu befürchten, dass betroffenen Schuldnerstaaten für sie günstige Zeitfenster wählen, um andere Staaten in die Mithaftung zu nehmen und quasi zu erpressen. Im Falle des ungeregelten Konkurses sind ökonomische Gesetze ausgeschaltet und es regiert allein das Gesetz der kurzfristigen politischen Macht. Darüber hinaus: Ohne konkrete Regelungen zu einer Staatsinsolvenz nehmen die Unsicherheiten im Vorfeld eines solchen Ereignisses extrem zu, mit entsprechenden Folgen für Finanzmärkte und Wechselkurse.
IV. Zur Notwendigkeit einer Insolvenzordnung für Staaten
Die bisherigen Überlegungen haben erstens klar gemacht, dass eine Staatsinsolvenz dramatische Folgen für eine Volkswirtschaft und die mit ihr verflochtenen Staaten haben kann. Zweitens zeigt sich, dass alle bisher praktizierten oder diskutierten Vorschläge zur Lösung dieses Problems mehr oder weniger große Schwächen haben. Aus diesem Grund soll hier ein einheitlicher, umfassender Lösungsansatz diskutiert werden, der die Stärken der obigen Überlegungen bündelt und ihre Schwächen meidet. Diesem Zweck könnte eine Insolvenzordnung für souveräne Staaten dienen, die alle Details einer Staatsinsolvenz beachtet und regelt. Grundsätzlich entspricht dieser Ansatz dem regulären Vorgehen in einer Volkswirtschaft mit Kreditbeziehungen – man legt bereits im Vorfeld, bei der Kreditvergabe, die Regularien fest, nach denen man im Falle von Zahlungsschwierigkeiten vorgeht. Wenn es eine Insolvenzordnung für Unternehmen gibt – warum soll es nicht auch eine für souveräne Staaten geben?
Wo liegen die Vorteile einer solchen Insolvenzordnung? Erstens dient eine solche Einrichtung dem Zweck, Unsicherheiten zu beseitigen: Wer einem Staat Geld leiht, der sich den Regelungen einer völkerrechtlich verbindlichen Konkursordnung unterwirft, hat exaktere Informationen über seine Verlustrisiken im Falle einer Insolvenz. Das macht das Investment in Anleihen von Staaten minderer Bonität transparenter und besser kalkulierbar, da man das politische Risiko herausnimmt, das nach einer solchen Insolvenz dadurch entsteht, dass über den Schuldenerlass verhandelt wird. Dies könnte im besten Fall sogar dazu führen, dass Staaten mit geringerer Bonität einen leichteren Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten erhalten.
Diese Verteilungskämpfe zwischen Gläubigern, die im Falle einer Insolvenz entstehen, werden durch eine verbindliche Konkursordnung unterbunden. Damit verbunden ist der zweite Vorteil einer solchen Regelung: Man eliminiert die Gefahr, dass ein Schuldenerlass an dem Veto-Recht weniger Anleger scheitert, die diese Position zu ihrem Vorteil ausnutzen – ein weiterer Vorzug einer Insolvenzregelung.
Drittens verhindert eine verbindliche und transparente Insolvenzordnung die Entstehung von Unsicherheit darüber, ob, wann und in welchem Umfang ein Land umschulden wird. Schlimmstenfalls allerdings führt diese Unsicherheit dazu, dass eine Staatspleite zu einer selbst erfüllenden Prophezeiung wird: Je mehr Anleger eine Insolvenz erwarten, umso mehr Anleger werden ihre Gelder abziehen, die Zinslast und Kapitalnot des betreffenden Landes erhöhen und schlimmstenfalls dadurch die Insolvenz herbeiführen. Diese Erwartung kann eine irrationale Eigendynamik entfalten. Man könnte das in Anlehnung an einen bank-run als sovereign-debt-run bezeichnen: Die Erwartung einer Schuldenkrise löst eine Schuldenkrise aus.
Zu guter Letzt reduziert eine solche Insolvenzordnung den politischen Druck auf andere Staaten, Pleitestaaten finanziell beizuspringen und dadurch das Fundament für weitere Schuldenkrisen zu legen. Eine international verankerte Insolvenzordnung für Staaten verhindert den politisch motivierten bail-out hochverschuldeter Staaten mit all seinen negativen Folgen.
Der ordnungspolitische Unterschied zwischen einer solchen Insolvenzordnung für Staaten und einem oft debattierten Restrukturierungsmechanismus von Staatsschulden (vgl. bspw. Krueger 2002) besteht darin, dass er bereits vor der Entstehung eines Schuldenproblems greifen und dieses damit verhindern soll. Es geht hier also nicht darum, Regelungen für die Zeit nach einer Staatsinsolvenz, sondern für die Zeit vor einem solchen Ereignis zu treffen. Insofern lehnt sich diese Idee eng an die übliche Prozedur bei der Insolvenz von Unternehmen an: Man trifft im Voraus Vereinbarungen darüber, wie im Fall einer Insolvenz zu verfahren ist. Allerdings gilt es, spezifische Unterschiede zwischen Unternehmen und souveränen Staaten zu beachten:
Zum einen können Staaten sich im Gegensatz zu Unternehmen über höhere Steuern (oder die Inflationssteuer) ihrer internen Verschuldung entledigen. Das funktioniert aber auch nicht unbegrenzt; es droht in solchen Fällen Kapitalflucht und Schwarzarbeit. Die externe Verschuldung allerdings lässt sich nur über eine Begleichung der Schulden oder über eine Insolvenz beseitigen.
Bei überschuldeten Staaten ist die Möglichkeit, auf Sicherheiten zurückzugreifen, beschränkt, da staatliche Vermögensgegenstände zumeist keinen oder nur einen geringen Marktwert haben, immobil, immateriell sind oder aber es politisch nicht machbar ist, solche Vermögensgegenstände zu pfänden (Wissenschaftlicher Beirat 2010). Ein Staat kann nicht wie ein Unternehmen liquidiert werden, sondern er muss in der Lage bleiben, seine Funktionen wahrzunehmen (vgl. Beck, Wentzel 2010). Deswegen kann es bei einer Insolvenz nicht um maximale Auszahlungsquote gehen, sondern nur darum, einen vertretbaren Ausgleich zwischen Gläubiger und Schuldner zu erzielen. Allerdings ist festzustellen, dass in einigen hochverschuldeten Ländern – etwa Griechenland oder Portugal – noch beachtliche Privatisierungspotenziale stecken, die gleichermaßen zu staatlichen Ausgabenreduktionen und Einnahmeverbesserungen führen könnten. Auch dieser Gesichtspunkt ist bei den ordnungspolitischen Auflagen für Schuldnerländer dringend zu berücksichtigen.
Der wohl wichtigste Unterschied zwischen einem staatlichen und einem privaten Gläubiger aber besteht darin, dass Ansprüche internationaler Gläubiger an souveräne Staaten de facto nicht durchsetzbar sind. Weigert sich ein Staat, seine Schulden an ausländische Gläubiger zurück zu zahlen, so gibt es keinerlei Rechtsmittel, diesen zu belangen. Man kann allenfalls ausländische Vermögenswerte pfänden, was vereinzelt schon versucht wurde (Beck, Prinz 2011), allerdings mit wenig Erfolg. Letztlich gibt es wenige Möglichkeiten, einen souveränen Staat zu zwingen, sich internationalen Gesetzen zu unterwerfen, sieht man einmal von der (Un-)Möglichkeit militärischer Intervention ab. Die vermutlich effektivste Methode, Druck auf (kleinere) Länder auszuüben, ist der erschwerte Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten.
V. Ordnungspolitischer Rahmen: Ziele und Gestaltungsprinzipien für eine Insolvenzordnung
Aus den bisherigen Überlegungen ergeben sich einfache Forderungen für die Ziele einer solchen Insolvenzordnung.
Es muss erstens sichergestellt werden, dass der betreffende Staat auch nach der Insolvenz die regulären Amtsgeschäfte weiterführen kann – der laufende Betrieb muss sichergestellt werden. Hier sind in erster Linie die Institutionen des Rechtschutzstaates gemeint und nicht die Ausgaben des ausgeuferten Leistungsstaates, der häufig die eigentliche Ursache fiskalischer (konsumtiver) Defizite ist.
Zweitens gilt es, eine systemische Krise zu vermeiden, bei der die Probleme des insolventen Staates auf andere Staaten oder deren Finanzsysteme übergreifen. Ansteckungseffekte sind die Begründung dafür, dass im Finanzsektor zahlreiche Schutzvorkehrungen gegen Herdeneffekte („herding“) vorgesehen sind.
Drittens muss das Preissystem intakt bleiben (Eucken 1952/90), damit keine falschen Anreize oder eine Fehlallokation von Kapital entsteht. Das bedeutet, dass die Insolvenzordnung das Risiko, das mit einer Kreditvergabe an einen Staat einhergeht, nicht ausblenden darf. Das schließt zwingend eine Beteiligung der Gläubiger an den Kosten einer Umschuldung ein; ein bedingungsloses bail-out führt zu einer unkontrollierten Kreditvergabe ohne Rücksicht auf das länderspezifische Risiko und führt damit zu einer Fehlallokation von Kapital. Sobald die Kongruenz von Entscheidungsbefugnis und Verantwortung durchtrennt wird, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen – dies muss eine Insolvenzordnung vermeiden.
Viertens muss eine Beteiligung der Gläubiger an einer Umschuldung festgeschrieben werden. Hierdurch verringert man auch die Unsicherheit bezüglich des Ausganges einer möglichen Insolvenz, was die Gefahr eines sovereign-debt-run reduziert.
Fünftens sollte ein Rückfall in Protektionismus vermieden werden – die Beschränkung des Güterhandels oder der Faktorwanderungen wäre für die Sanierung eines Staatshaushaltes langfristig kontraproduktiv. Eine klare Regelung verhindert auch drohende Verteilungskämpfe der Gläubiger, die eine Umschuldung ins Wanken bringen können.
Sechstens sollte eine Insolvenzordnung auch dazu dienen, die Ursachen der staatlichen Überschuldung zu beseitigen – andernfalls müsste man damit rechnen, dass eine Umschuldung die nächste jagt. Die politisch motivierten Verstöße gegen die konstituierenden Prinzipien einer Wettbewerbsordnung im Euckenschen Verständnis sind zu minimieren, um zukünftige Finanzkrisen unwahrscheinlicher zu machen. Insofern sollte jede Lösung auch präventiven Charakter aufweisen.
Mit Hilfe dieser Ziele lässt sich der ordnungspolitische Rahmen abstecken, innerhalb dessen sich mögliche Lösungsansätze bewegen müssen: Es müssen weiterhin Anreize zu wirtschaftlichem Verhalten existieren, und zwar sowohl auf Seiten der Gläubiger als auch der Schuldner. Das wiederum wird sich nur bewerkstelligen lassen, wenn man das Preissystem der internationalen Kapitalmärkte intakt lässt – jegliche Maßnahme, die zu einer Verfälschung der relativen Preise führt, dürfte sich als kontraproduktiv erweisen.
VI. Grundmuster einer Insolvenzordnung für Staaten
Welche Aspekte einer staatlichen Insolvenz gilt es zu regeln? Orientiert man sich an herkömmlichen Insolvenzverfahren, so ergeben sich folgende Problemkreise und Fragen: Ab wann ist ein Staat insolvent und ab wann greift die betreffende Insolvenzordnung? Eine der wohl schwierigsten Fragen ist, wie man diese Regelungen für souveräne Staaten bindend macht. Sicherlich bedarf es hier einer internationalen Institution. Dann muss festgelegt werden, nach welchen Regeln die Lasten aus der Umschuldung auf die Beteiligten verteilt werden. Eine weitere Entscheidung betrifft die Frage, ob und wenn ja wie im Rahmen eines Insolvenzverfahrens einem Staat Auflagen gemacht werden. Diese vier Fragenkomplexe sollen im Folgenden untersucht werden.
1. Feststellung der Insolvenz
Eine Insolvenz liegt gemeinhin dann vor, wenn die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Schuldners nicht mehr dazu ausreicht, allen seinen Verpflichtungen im vollen Umfang nachzukommen. Da wie bereits gesehen, ein Staat lediglich im Außenverhältnis insolvent werden kann, liegt es nahe, bei der Feststellung einer Insolvenz auf Kennzahlen abzustellen, welche die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in Relation stellen zu den Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland. Ansatzpunkte hierfür sind unter anderem (vgl. Beck, Wentzel 2010):
- Als Kennzahlen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit kommen das Sozialprodukt, die Investitionsausgaben oder das Wachstum in Frage. Besondere Berücksichtigung sollten hier die Exporterlöse finden. Sie geben Auskunft über die Fähigkeit eines Landes, ausländische Devisen zu erzielen, mit deren Hilfe sie die Verschuldung gegenüber dem Ausland abtragen können. Sicherlich gibt es sehr reiche Länder, die dennoch überschuldet sind – etwa die USA, während vergleichsweise ärmere Länder fast schuldenfrei sein können – etwa Slowenien. Deshalb sind weitere Kennzahlen ergänzend zu berücksichtigen.
- Als Kennzeichen der Verschuldung gegenüber dem Ausland kann man neben dem Schuldenstand auf die Zinszahlungen ans Ausland, den Anteil der Zinszahlungen am Staatsbudget oder den Zinsabstand zu den Staatsanleihen anderer Länder abstellen.
- Weiterhin interessieren die Stromgrößen, also die regelmäßigen Devisenab- oder –zuflüsse, sowie die Handels- oder Kapitalströme. Sie sind ein klassisches Indiz für die Attraktivität eines Investitionsstandortes; je höher die Devisen- und Kapitalzuflüsse aus diesen Stromgrößen sind, desto größer kann man die Fähigkeit eines Landes einschätzen, seine Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland aus dem laufenden Einkommen zu begleichen.
- Ein Blick auf die Bestandsgrößen kann das Bild ergänzen: Der Bestand an Devisen gibt Auskunft darüber, wie lange ein ganzes Land bei gegebenen Abflüssen grundsätzlich noch seinen Verpflichtungen nachkommen kann; abgerundet wird das durch den Bestand an Auslandsschulden. Die sonstigen Vermögensbestände des betroffenen Staates sind aus den bereits genannten Gründen wenig hilfreich bei der Lösung des Schuldenproblems.
Mit Hilfe dieser Kennzahlen ließe sich ein wissenschaftlich genaueres und zugleich politisch pragmatisches Urteil darüber gewinnen, ob oder wann ein Staat eine Umschuldung benötigt. Das Problem an einem solchen Kennzahlensystem ist allerdings ein strategisches: Je enger sich ein Land ausweislich seiner Daten dem Punkt nähert, an dem eine Umschuldung notwendig wird, um so eher muss man damit rechnen, dass dieser Punkt auch erreicht wird, weil Investoren ihr Kapital abziehen werden, sobald sie befürchten, dass die Schwelle zur Umschuldung erreicht wird. Dies ist ein Zielkonflikt: Aus Gründen der Transparenz und Investitionssicherheit müsste man Klarheit darüber schaffen, wann eine Umschuldungsaktion ausgelöst wird, doch genau diese Transparenz kann dazu führen, dass ein verfrühter sovereign-debt-run ausgelöst wird und der Staatsbankrott zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung wird. Mit diesem Ankündigungsproblem haben schon die Rating-Agenturen massiv zu kämpfen. Schon eine minimale Veränderung ihrer Bewertung kann die Schuldendienstfähigkeit eines Landes unter bestimmten Konstellationen unverhältnismäßig verschlechtern.
Die Lösungsmöglichkeiten für dieses Problem sind gering: lässt man die Gläubiger im Unklaren darüber, wann mit der Umschuldung begonnen wird, so geht das auf Kosten der Transparenz und Investitionssicherheit; schafft man diese Transparenz, provoziert man möglicherweise einen Automatismus in Richtung Umschuldung. Selbstverständlich gibt es abgestufte Bonitäten von Schuldnern. Aber bei der Gretchenfrage, ob ein Land noch zahlungsfähig ist oder nicht, läuft es letztlich auf eine digitale Ja-Nein-Entscheidung hinaus, wie im Falle Griechenlands klar zu erkennen ist. Eine Abschwächung dieses Problems könnte man erreichen, indem man die Umschuldung nicht als ein einziges Großereignis organisiert, sondern als schrittweisen Prozess – man führt also mehrere Eskalationsstufen im Umschuldungsprozess ein. Man errichtet mehrere Schwellen, ab denen jeweils neue Maßnahmen der Umschuldung getroffen werden. Damit existiert zwar immer noch das Problem, dass bei einer Näherung an diese Schwelle diese aufgrund der Erwartungen der Gläubiger mehr oder weniger automatisch erreicht wird. Liegen die einzelnen Schwellen jedoch weit genug auseinander, so könnte man einen kompletten sovereign-debt-run verhindern. Zusätzliche verpflichtende Konsolidierungsmaßnahmen beim Erreichen solcher Schwellen können dieses Problem zusätzlich dämpfen.
Dieses Argument spricht dafür, eine Staatsinsolvenz nicht als einen einmaligen Vorgang, sondern als graduellen, schrittweisen Prozess zu verstehen. Dieser Gedanke soll später noch einmal aufgegriffen werden.
2. Bindungskraft: Eine supranationale Insolvenzordnung
Das schwierigste Problem ist die Frage, wie man eine Bindungskraft einer solchen Insolvenzordnung schafft. Natürlich können Staaten in feierlichen Zeremonien Verträge unterzeichnen – wohl wissend, dass man im Ernstfall nachverhandelt oder diese Verträge ignoriert. Die einzige Institution, die echte Bindungskraft schaffen kann, sind entsprechende Vorteile, die man von der langfristigen Einhaltung solcher Verträge erwarten kann; möglicherweise ergänzt durch Sicherheiten, auf welche die Gläubiger im Ernstfall auch ohne das Zugeständnis des insolventen Staates zugreifen können.
Eine Insolvenzordnung für Staaten erfordert also eine Institution, von deren Mitgliedschaft sich Staaten so große Vorteile versprechen, dass sie bereit sind, sich an deren Regeln zu halten. Eine solche Institution könnte eine internationale Staatengemeinschaft sein, die einzelne Staatsanleihen gegen das Risiko einer Insolvenz absichert. Wie könnten die einzelnen Konstruktionsmerkmale einer solchen Gemeinschaft aussehen?
Ziel dieser Institution soll es sein, klare Regelungen im Falle einer staatlichen Insolvenz zu schaffen und deren Einhaltung zu überwachen. Die teilnehmenden Staaten hinterlegen eine Kapitaleinlage, mit der die Institution finanziert wird. Zusätzlich zahlen sie jährliche Beiträge, mit denen die Aufgaben der Institution finanziert werden.
Die wichtigste Aufgabe der Institution besteht darin, dass sie einen näher zu bestimmenden Teil der Kapitalmarktschulden des betreffenden Landes zu einer näher festzulegenden Quote versichert; im Falle des Zahlungsausfalls springt die Institution dann bis zur Höhe der Quote für den betreffenden Staat ein. Diese Absicherung der Anleihen des betreffenden Landes kann man an vorher festgelegte Auflagen binden. Zugleich ist für jede Emission exakt festgelegt, welche Umstrukturierungsmaßnahmen ergriffen werden. Die Staaten müssen quasi bekennen, wofür genau sie das aufgenommene Kapital einsetzen wollen.
Wichtig ist dabei, dass nicht die Schulden eines Landes als Ganzes besichert werden, sondern einzelne Emissionen. Die Versicherungskonditionen können je nach Laufzeit, Risiko und Kupon unterschiedlich ausfallen – der zu zahlende Beitrag, die Höhe der Absicherung und mögliche Auflagen, die mit dem Eintritt des Versicherungsfalls verbunden sind, werden je nach Emission gestaffelt.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dieser Institution also um eine supranationale Versicherungsgesellschaft gegen den Ausfall von Staatsschulden. Inwieweit ist diese Organisation geeignet, die Probleme eines Staatsbankrotts zu bekämpfen?
Zunächst einmal muss man nach den Anreizen für die Mitgliedstaaten fragen. Der wichtigste Anreiz besteht darin, dass durch eine Mitgliedschaft in dieser Organisation dem betreffenden Land die Kapitalaufnahme erleichtert wird – die Mitgliedschaft in einer solchen Institution sichert den internationalen Gläubigern erstens zu, dass ein Teil ihres Geldes vor einem Ausfall gesichert ist; das reduziert den Zinssatz für diese Schulden. Noch wichtiger: Die Unsicherheit bezüglich dessen, was im Falle einer staatlichen Insolvenz passiert, ist geklärt, wenn sich das betreffende Land an die Regelungen hält, welche die Institution vorschreibt. Das erleichtert die Kalkulation des Risikos, reduziert die Unsicherheit und senkt dadurch tendenziell die Risikoprämie, die ein Staat auf seine Schulden zahlen muss.
Ein wichtiger Vorteil dieses Arrangements besteht in der versicherungsimmanenten Umverteilung, die dieses Schema mit sich bringt: Die Beiträge zu dieser Institution werden nach Umfang der zu versichernden Schulden, den wirtschaftlichen Kennzahlen des Landes und seiner Schuldenhistorie gestaffelt. Wer schlechte wirtschaftliche Daten aufweist, sich hoch verschuldet oder Zahlungen aussetzt, muss entsprechend höhere Beiträge zahlen. Damit wird dieses Arrangement zu einer Art Versicherung gegen staatlichen Zahlungsausfall, getragen und gezahlt von den Staaten selbst. Für eine solche Versicherung spricht der oben erläuterte Umstand, dass ab einem bestimmten Schuldenstand Staatsverschuldung zu einem nicht-linearen, nicht mehr zu beherrschenden Prozess wird – ab einem bestimmten Schuldenstand muss man vermuten, dass eine Regierung die Kontrolle über ihre Verschuldung verliert. In vorher fest definierten Fällen springt die Versicherungsgemeinschaft als Solidargemeinschaft ein – im Zweifelsfall ein unschätzbarer Vorteil.
Natürlich muss man bei einer solchen Institution Vorkehrungen gegen moral hazard treffen, wie er immer bei Versicherungen auftritt. Das ex-ante-moral hazard besteht darin, dass der Versicherte sein Verhalten bereits vor Eintritt des Schadensfalls ändert, alleine aufgrund der Tatsache, dass er versichert ist. Im diesem Fall könnte das bedeuten, dass ein Land mit seiner Verschuldung laxer umgeht, weil es um die Existenz der Versicherung weiß. Dieser Gefahr lässt sich mit versicherungsüblichen Methoden vorbeugen: Beim Eintritt eines Schadensfalls – eine Anleihe des Staates, die durch die Institution besichert ist, wird notleidend – erhöht sich für weitere, spätere Versicherungsfälle der Beitrag, den der betreffende Staat zahlen muss. Zudem spricht dieses Argument dafür, Anleihen nicht zu 100 Prozent zu besichern, sondern einen Selbstbehalt vorzusehen – dies ist ein wichtiger Anreiz, um auf Seiten der Gläubiger moral hazard zu vermeiden. Andernfalls würden diese solche Anleihen stets kaufen, da ja eine komplette Rückzahlung garantiert ist. Durch einen hinreichenden Selbstbehalt bleibt das Preissystem der Kapitalmärkte intakt.
Auch gegen ex-post-moral-hazard – tritt der Schadensfall ein, ändert der Versicherte sein Verhalten – kann man sich absichern: Indem bereits im Voraus festgelegt wird, was im Falle einer Insolvenz passiert, gibt es für den Eintritt des Schadensfalls fest definierte Verhaltensregeln; ex-post-moral-hazard wird dadurch schlecht möglich. Hält sich der betreffende Staat nicht an diese Vereinbarungen, so wird er von diesem Arrangement ausgeschlossen; dieses Versäumnis bezahlt er mit einem Verlust seiner Sicherungseinlage und im Falle einer späteren Rückkehr mit entsprechenden Aufschlägen auf seine Beiträge.
Damit hat ein Staat Anreize, sich an dieses Arrangement zu halten: Zunächst einmal kann man die Kapitaleinlage als Sicherheit nehmen – hält sich das Land nicht an das vereinbarte Arrangement, so verwendet man diese Kapitaleinlage, um die Forderungen der Gläubiger zumindest teilweise zu befriedigen. Zweitens zieht Fehlverhalten einen Ausschluss von diesem Arrangement nach sich; wer die Vorteile dieser Institution nutzen will, wird dies zu vermeiden suchen. Zudem schaffen die Aufschläge im Falle eines späteren Wiedereintritts weitere Anreize, sich regelkonform zu verhalten.
Das Problem eines vorzeitigen sovereign-debt-runs, wenn sich ein Land einer Schwelle nähert, bei der Umschuldungen einsetzt, wird dadurch gelindert, dass diese Schwellen stets nur einzelne Emissionen eines Landes, aber nicht alle seine Schulden betreffen. Für jede Emission kann ein Land also unterschiedliche Absicherungsmodalitäten sowie unterschiedliche Schwellenwerte vereinbaren, bei denen eine Umschuldung angestoßen wird. Natürlich hat man dann für die betreffende Einzelemission immer noch das Problem, dass bereits vor dem Erreichen dieses Schwellenwertes mit einem run zu rechnen ist, doch im Unterschied zum bisherigem Regime bezieht sich das nun lediglich auf eine Emission, also auf einen geringen Teil der Gesamtschulden. Dennoch nimmt diese Vorgehensweise Unsicherheit vom Markt, indem die Marktteilnehmer nun genau wissen, wann es zu Umschuldungen kommt und zu welchen Konditionen. Im bisherigen Regime weiß man keines von beiden, so dass es zu Überreaktionen am Markt kommen kann, sowohl was den Zeitpunkt des runs als auch dessen Ausmaß angeht.
Indem nur einzelne Emissionen zur Umschuldung anstehen, senkt das die systemischen Risiken eines Staatsbankrotts. Allerdings ist auch klar, dass mit der Umschuldung erster Emissionen die weitere Schuldenaufnahme für einen Staat teurer wird. Erfolgen die ersten Umschuldungen zeitig, so kann dies helfen, gegenzusteuern, indem der betreffende Staat deutlich früher als bisher durch steigende Zinskosten angehalten wird, seinen Haushalt zu sanieren. In diesem Fall wäre das hier besprochene Regime eine Art Frühwarnsystem, das den Märkten und den Staaten wesentlich früher als bisher anzeigt, dass ein Staat seine Finanzen in Ordnung bringen muss.
Diese Organisation hat auch einen wettbewerblichen Aspekt: Staaten können unbesehen ihrer Mitgliedschaft in diesem Arrangement auch weiterhin Emissionen begeben, die nicht von diesem Regime abgesichert werden – diese Anleihen haben dann aber auch keinen Schutz durch die Sicherungseinrichtung und werden mit einem entsprechenden Aufschlag auf die Zinsen gehandelt. Damit können Staaten auch weiterhin ganz normal die Kapitalmärkte beanspruchen; die Gläubiger wissen dann allerdings, dass diese Anleihen mit einem höheren Risiko verbunden sind. Damit kann der Markt weiterhin ein Urteil über die Finanzlage eines Staates fällen – je solider ein Staat finanziert ist, umso geringer ist der Aufschlag auf die nicht-besicherten Anleihen. Damit kann ein Staat auch dezidiert je nach Verwendungszweck die Art der Emission wählen - die Besicherung der Anleihen bietet sich beispielsweise für Geld an, das zur Finanzierung der laufenden Staatsaufgaben verwendet wird; damit sichert man den laufenden Staatsbetrieb ab.
3. Verteilung der Lasten
Bei der Verteilung der Lasten gilt es zwei Ebenen zu unterscheiden: Die Verteilung der Lasten einer Umschuldung zwischen Gläubiger und Schuldner und die Verteilung der Lasten der Folgen einer Staatsinsolvenz auf die internationale Staatengemeinschaft.
Den ersten Verteilungsfall kann man in dem hier vorgeschlagenen Arrangement marktwirtschaftlich lösen: Eine Regierung bietet eine Anleihe an, die durch das Sicherungsschema abgesichert ist und macht die Lastenverteilung im Falle einer Umschuldung zum Gegenstand des Bieterverfahrens – je höher die Absicherung, desto geringer der Kupon. Man kann sich dabei auch tranchierte Emissionen vorstellen, die je nach Grad der Absicherung unterschiedliche Konditionen bieten. Damit entscheidet der Markt darüber, welche Absicherungskonditionen zu welchem Preis akzeptabel sind – und das bevor es zu einer Umschuldung kommt.
Die Verteilung der Lasten einer Umschuldung auf die internationale Staatengemeinschaft ist da schon schwieriger zu regeln. Zunächst einmal gibt es im Rahmen dieses Schemas eine versicherungsimmanente Umverteilung, deren Ausmaß sich aber durch die Vorkehrungen gegen den moral hazard in Grenzen halten wird – und muss, da man ansonsten wieder falsche Anreize setzen würde.
Bleibt die Frage, ob man im Rahmen dieses Systems auch politisch motivierte Transfers ermöglichen soll. Ökonomisch betrachtet muss man diese Frage verneinen, darf sich aber auch nicht der Tatsache verschließen, dass auch solche Institutionen stets ein Spielball politischer Interessen sein werden – es geht also darum, Fehlanreize zu minimieren. Eine Möglichkeit könnte bei den Kapitaleinlagen ansetzen, welche die Staaten leisten müssen – hier wären transparente Transfers durch die Staatsgemeinschaft möglich; beispielsweise als Belohnung für gutes Schuldenverhalten. Möglicherweise könnte man sich hier Vorbilder bei den Sonderziehungsrechten des Internationalen Währungsfonds suchen. Allerdings muss man sich darüber bewusst sein, dass man hier eine Tür für politische Manipulation öffnet – deren Folgen zumeist wenig effizient sind.
4. Auflagenpolitik
Was die Frage der Auflagen angeht, besteht ein Zielkonflikt zwischen Souveränität und Effizienz: Je enger das Auflagenkorsett, um so eher verhindert man einen moral hazard der Schuldner-Staaten, aber umso mehr wird in die nationale Souveränität der Schuldner eingegriffen, inklusive der entsprechenden politischen Probleme. In diesem Zusammenhang wird man die Frage beantworten müssen, welche Gremien diese Auflagen festlegen – diese wird man politisch klären müssen; einigt man sich auf ein Gremium der beteiligten Staaten, dann wäre der Souveränitätsverlust im Grunde genommen freiwillig.
Eine Möglichkeit besteht darin, die Absicherung der Organisation nur für zweckgebundene Anleihen zuzulassen, also Schulden, von denen man vermutet, dass die mit ihnen finanzierten Objekte eine Rückzahlung der Schulden wahrscheinlich machen. Man könnte sozusagen durch die Hintertür der Besicherung der Anleihen und die damit verbundenen Auflagen die goldene Regel der Staatsverschuldung einführen – Absicherungen werden nur an solche Anleihen vergeben, deren Verwendungszweck der goldenen Regel entspricht. Damit ließe sich durchaus eine gewisse Auflagenpolitik durchsetzen, ohne dass dies als direkte Auflage empfunden wird. Der Trick daran besteht also letztlich darin, die Auflagen an die Mittelvergabe zu koppeln, bevor es zum Ernstfall gekommen ist. Dabei kann man auch die Möglichkeit diskutieren, den Grad der Auflagen mit zunehmender Verschlechterung der Finanzlage eines Landes zu steigern: Ein Land mit guten wirtschaftlichen Rahmendaten kann seine Emissionen ohne größere Auflagen absichern, doch je mehr sich die Finanzlage eines Landes verschlechtert, um so verbindlicher und detaillierter werden die Auflagen, die erforderlich sind, um in den Genuss der Absicherung der Schulden zu kommen. Eine graduelle Abstufung der Auflagen hat zudem den Vorteil, dass pro-zyklische Wirkungen vermieden werden, wie sie im Zusammenhang mit den drastischen Sparmaßnahmen in Portugal und Griechenland zu beobachten sind.
VII. Folgerungen für Wirtschaftspolitik und -theorie
1. Mehr Verbindlichkeit
Der Erfolg einer Insolvenzordnung für Staaten steht und fällt mit ihrer Glaubwürdigkeit und der Einhaltung ihrer Regeln durch souveräne Staaten. Es geht also darum, Staaten die Möglichkeit zu geben, sich in einem Moment der Stärke eine Selbstbindung aufzuerlegen, die sich nachträglich nur mit sehr hohen Kosten abwerfen lässt. Vielleicht ist Deutschland mit der Schuldenbremse eine solche Selbstbindung gelungen. Die Bindungskraft und die Glaubwürdigkeit sollen in dem hier gemachten Vorschlag durch die Vorteile an der Teilnahme an diesem Mechanismus und durch die Hinterlegung von Kapital erreicht werden; und die aus einem Fehlverhalten entstehenden Nachteile müssen automatisch eintreten und dürfen keiner politischen Entscheidung unterliegen.
Ein Maximum an Politikferne wäre für das hier vorgeschlagene Schema erreichbar, wenn man die Sicherungseinrichtung in die Hände mehrerer privater Unternehmen legen würde, also eine Art Wettbewerb der Versicherungen um die Absicherung von Staatsschulden – eine politisch eher unrealistische Vorstellung. Solange die Leitung eines solchen Gremiums in den Händen der Politik liegt, muss man immer mit politisch motivierten Eingriffen und den damit verbundenen Fehlanreizen und Fehlentwicklungen rechnen. In letzter Instanz lassen sich souveräne Staaten durch keine politischen Maßnahmen bändigen – bis die Schwerkraft der ökonomischen Gesetze sie auf den Boden der Tatsachen zurückholt.
2. Mehr Transparenz
Sicherlich würde deutlich mehr Transparenz im Budgetwesen helfen, die politischen Ursachen von Staatsverschuldung einzudämmen (vgl. Beck, Prinz 2011): Man führt drei getrennte Haushaltsbereiche ein – einen Investitionshaushalt, einen Konjunkturhaushalt und den Haushalt für das laufende Geschäft. Jeder dieser Haushalte hat damit unterschiedliche Funktionen, die klar getrennt sind.
Verschulden darf sich die Regierung dann nur für den Investitionshaushalt, in dem alle langfristigen Investitionsprojekte verbucht werden. Die Politiker müssen explizit die Projekte anführen, für die sie sich verschulden wollen und dürfen, weil es sich um Investitionen handelt. Diese Investitionsprojekte sollten einer langfristigen Erfolgskontrolle unterzogen werden. Allerdings ist diese Erfolgskontrolle nicht so einfach wie bei einem Unternehmen, weil sich viele staatliche Investitionen nicht unmittelbar in einer Rendite ausdrücken, sondern in mehr Wachstum. Aber immerhin würden ein solcher Haushalt und eine langjährige Erfolgskontrolle der aus ihm finanzierten Projekte die Politik unter Erklärungsdruck gegenüber der Öffentlichkeit setzen. Dieser Erklärungsdruck bewirkt auch, dass sich langfristig nicht jegliche Art von Ausgaben als Investition ausweisen lässt. Man muss sich fragen, warum die Erfolgskontrolle staatlicher Investitionen nicht schon längst transparenter ist und institutionalisiert wird.
Haushalt Nummer zwei wäre der Konjunkturhaushalt; hier werden konjunkturbedingte Ausgaben und Einnahmen eingestellt. Für diesen Bereich darf sich der Staat nur kurzfristig verschulden, langfristig muss dieser Haushalt ausgeglichen sein. In Boomzeiten soll dieser Haushalt hohe Überschüsse aufweisen, die er dann in Krisenzeiten für expansive Konjunkturpolitik ausgeben kann. Aufgrund der insgesamt eher negativen Erfahrungen mit der antizyklischen Globalsteuerung wären diesem Haushalt jedoch enge Fesseln anzulegen, um dem Dauerargument der (vermeintlich) konjunkturellen Krise wirksam entgegenzusteuern.
Der dritte Haushalt ist der Haushalt für das laufende Geschäft – hier darf sich der Staat nicht verschulden. Und um sicher zu gehen, sollte man eine Notfallrücklage für unvorhergesehene Ausgaben bilden. Natürlich bildet dieser Haushalt ein Einfallstor für Budgetmissbrauch, diesen Preis muss man um der notwendigen Flexibilität des Haushaltes hinnehmen.
Durch die Trennung der Haushalte erhalten alle Ausgaben und die Kredite eine eindeutige Zuordnung – das erschwert die politisch motivierte Schuldenaufnahme. Natürlich hat die Regierung das Recht, die verschiedenen Haushalte in ihrem Volumen zu bestimmen, doch werden sie sich mit diesem Volumen dem Votum des Bürgers stellen müssen - jede Ausgabe, jeder Kredit, muss gerechtfertigt werden und wird auch auf lange Frist auf seine Rechtfertigung überprüft, auch vom Wähler. Vielleicht wäre das wenigstens ein Schritt zur Eindämmung der Schuldenexzesse – ein kleiner Schritt auf einem langen Weg.
3. Das Bankenproblem
Eines der großen Risiken einer überbordenden Staatsverschuldung entsteht durch den privaten Bankenkanal. Eine Insolvenz von Griechenland wäre ein weniger dringliches Problem, wenn da nicht die Kredite der ausländischen Banken wären (vgl. BIS 2011), Irland hat seine Budget-Probleme nur wegen seiner Banken – die Voraussetzung für eine gescheite Insolvenzordnung von Staaten ist es also, Banken wetterfest zu machen – der Erfolg dieser Maßnahme bedingt den Erfolg der Insolvenzordnung.
Die Liste der notwendigen Maßnahmen ist rasch benannt: Banken brauchen einen besseren Risikopuffer, der sich an den tatsächlichen Risiken einer Bank orientiert und auch Liquidität als eigene Risikoklasse berücksichtigt, und Banken müssen möglicherweise eine stärkere Risikodiversifizierung vornehmen. Zudem muss die Bankenaufsicht ausgeweitet werden auf alle Institutionen, die bankähnliches Geschäft betreiben – die Zeit der Schattenbanken (vgl. Sachverständigenrat 2008) muss beendet werden. Eine Insolvenzordnung für Staaten setzt auch eine Insolvenzordnung für Banken respektive systemisch relevante Institutionen voraus. Grundsätzlich ist die Wettbewerbsordnung im Bankensektor zu stärken, um durch Dekonzentration zu weniger anfälligen Unternehmensgrößen zu gelangen.
Ferner sind Vorkehrungen zu treffen, dass die EZB nicht zur dauerhaften Endlagerstätte für notleidende Staatsanleihen degeneriert. Die Verlagerung der Insolvenz von Privatbanken in die Bilanz der EZB kommt einer zusätzlichen und politisch motivierten Geldschöpfung sehr nahe.
4. Das Politikproblem
Eine Ursache einer Staatsinsolvenz können wie gezeigt unrentable Investitionen sein. Der tiefere Grund dieser Entwicklung können eine unsachgemäße Förderungspolitik ebenso wie eine falsche Geld- und Wechselkurspolitik sein. Der präventive Schutz vor einer staatlichen Insolvenz umfasst also auch Zurückhaltung bei staatlicher Investitionsförderung ebenso wie eine adäquate Geld- und Wechselkurspolitik.
Das Risiko eines politisch motivierten bail-out besteht noch immer – jegliche vertragliche Vorkehrung gegen ein solches bail-out wird daran leiden, dass Staaten sich im Zweifelsfall aus politischen Motiven darüber hinwegsetzen können. Das spricht dafür, die hier vorgeschlagene Lösung in die Hände privater, miteinander im Wettbewerb stehender Unternehmen zu legen – das würde ein politisch motiviertes bail-out deutlich erschweren, wenngleich nicht unmöglich machen. Die Staatengemeinschaft könnte sich immer noch entschließen, direkte Transfers an ein Land zu zahlen. Immerhin wären die Transfers dadurch deutlich transparenter, was die Chance erhöhen würde, dass die Verantwortlichen sich im politischen Prozess rechtfertigen müssen.
5. Praktische und theoretische Einwände
Ein Einwand der betroffenen Staaten gegen die bindende Insolvenzordnung und gegen die anschließende Versicherungslösung könnte darin bestehen, dass dieses Regime die Kosten ihrer Staatsverschuldung verteuern. Richtig an diesem Argument ist, dass durch die Mitgliedschaft in diesem Schema Kosten entstehen. Diesen Kosten stehen allerdings zwei Vorteile gegenüber: Zum einen werden die Finanzierungskosten durch die Absicherung der Emissionen und die Reduktion der Unsicherheit sinken – das ist ein direkter Ertrag, der die Nettokosten für die Mitgliedschaft deutlich reduziert. Ein weiterer Ertrag der Mitgliedschaft besteht in der Versorgung mit einem Selbstbindungsmechanismus, der ein Ausufern der Staatsverschuldung erschwert – das ist sozusagen der Preis für das Versagen der Politik, die Schulden des Staates in einem vernünftigen Rahmen zu halten.
Ein eher versicherungstechnisches Problem könnte allerdings entstehen, wenn Staatsbankrotte stochastisch abhängige Ereignisse sind. Zieht ein Staatsbankrott in einer Kettenreaktion weitere Staaten in den Abgrund, wären die Kapazitäten der Sicherungseinrichtung rasch überfordert. Ein wenig gemildert wird dieses Problem dadurch, dass ja jeweils nur einzelne Emissionen zum Versicherungsfall werden; häufen sich die Ausfälle vieler Emissionen von vielen verschiedenen Staaten, so besteht die Möglichkeit, die Absicherungskonditionen nach oben anzupassen oder auch höhere Kapitaleinlagen zu fordern.
Dieses Argument spricht dafür, die Kapitaleinlage der teilnehmenden Staaten flexibel zu gestalten – in wirtschaftlich guten Zeiten wird diese aufgestockt, damit man genau für diese Zeiten Rücklagen hat, von denen man zehren kann. Damit würden die Einlagen zu einer Art internationalem Juliusturm, der Rücklagen vor den Begehrlichkeiten der Politik in Sicherheit bringt.
VIII. Zusammenfassung und Ausblick
Ein berühmtes Zitat von Heraklit sagt: „Wer den Frieden will, muss den Krieg vorbereiten“. In den gegenwärtig schwierigen Zeiten, in denen eine Finanzkrise die nächste ablöst und alle Probleme nur mit neuer und immer reichlicherer Liquidität bekämpft werden, ist eine grundsätzliche Neuordnung der internationalen Finanzbeziehungen dringend notwendig. In Abwandlung von Heraklit ist also zu sagen: „Wer finanzielle Stabilität von Staatshaushalten will, muss auch den möglichen Konkursfall vorbereiten“.
In dem vorliegenden Beitrag wurde gezeigt, dass staatliche Insolvenzen keine historische Ausnahme, sondern eher der Regelfall sind. Das Wagnersche Gesetz scheint ungebrochen gültig und wird auch durch die gesamte neuere, eher quantitativ ausgerichtete Literatur bestätigt. Eine Insolvenzordnung für Staaten ist ordnungspolitisch unverzichtbar. Allerdings kann eine Insolvenzordnung kurzfristig kaum durchgesetzt und implementiert werden. Vieles spricht jedoch dafür, dass zumindest im Falle Griechenlands ein partieller Währungsschnitt unvermeidbar sein dürfte.
Rettungsschirme und andere Liquiditätsspritzen dienen den Regierenden lediglich dazu, Zeit zu kaufen. Eigentlich stellen sie eine Form der Konkursverschleppung oder Konkursverschleierung dar. De facto sind sie eine Umgehung des no bail out-Verbots und damit einen Bruch des Art. 125 EU-Vertrag. Wenn aber die Währungsunion zur Transferunion wird, dann sind nicht nur der Euro gefährdet, sondern die bisherigen Erfolge der europäischen Integration. Ausufernde Fiskalpolitik lässt sich weder mit der Geldpolitik noch mit dauerhafter Umverteilung heilen.
Literatur
Ardagna, Silvia; Francesco Caselli; Timothy Lane (2006), Fiscal Discipline and the cost of public debt service, National Bureau of Economic Research Working Paper No.10788.
Beck, Hanno (2009): Wirtschaftspolitik und Psychologie: Zum Forschungsprogramm der Behavioral Economics, ORDO - Band 60 (2009), S. 119-151.
Beck, Hanno; Prinz, Aloys (2012), Staatsverschuldung, erscheint bei Beck-Verlag, 2012
Beck, Hanno; Prinz, Aloys (2011); Abgebrannt. Unsere Zukunft nach dem Schuldenkollaps, Hanser Verlag, 2011.
Beck, Hanno; Wentzel, Dirk (2010), Eine Insolvenzordnung für Staaten?, Wirtschaftsdienst, Heft 2, 90. Jg., S. 25 - 29.
Beck, Hanno; Wienert, Helmut (2010), Zur Reform des Rating-(Un)Wesens. Bestandsaufnahme und eine Reform-Option, Jahrbuch für Wirtschaftswissenschaften 2010 (61), S. 45 – 67.
BIS (2011), BIS Quarterly Review. International banking and financial market developments, March 2011.
Buchanan, James M., Wagner, Richard E. (1977), Democracy in Deficit, The Political Legacy of Lord Keynes, New York Academic Press.
Blanchard, Olivier; Giovanni Dell’Ariccia, and Paolo Mauro (2010). Rethinking macroeconomic policy. IMF Staff Position Note. February 12, 2010, Bd. SPN/10/03Borensztein, Eduardo; Ugo Panizza (2008) The Costs of Sovereign Default. IMF Working Paper. 2008, Bd. 08/238, October
Borensztein, Eduardo; Ugo Panizza (2006), Do Sovereign Defaults Hurt Exporters? Inter-American Development Bank Working Paper, Bd. No. 553
Checherita, Cristina und Rothe, Philipp (2010), The impact of high and growing government debt on economic growth. An empirical investigation for the Euro Area. Frankfurt: European Central Bank Working Paper Series No 1237.
Delpla, Jaques; von Weizäcker, Jakob (2011), Eurobonds: The blue bond concept and its implications, Bruegel Policy Contribution, Issue 2001/02, March 2011.
Downs, Anthony (1968), Die ökonomische Theorie der Demokratie, Tübingen.
Eucken, Walter (1952/1990), Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 6. Auflage, Tübingen.
Hankel, Wilhem, Nölling, Wilhelm, Schachtschneider, Karl Albrecht und Joachim Starbatty (2001), Die EURO-Illusion. Ist Europa noch zu retten? Verlag Rororo.
IMF (2008a), IMF Agrees $15.7 Billion Loan to Bolster Hungary's Finances, URL www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2008/car110608a.htm
IMF (2008b), IMF Set to Lend $2.4 Billion to Latvia, URL www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2008/car121908a.htm
Issing, Otmar (2010), Gefahr für die Stabilität, in: FAZ, Nr. 263, 11. November 2010, S. 14.
Jaeger, Markus (2010), Kapitalzuflüsse in Schwellenländer – wo rangieren dabei die BRIC-Länder?, Deutsche Bank Research, Frankfurt.
Kindleberger, Charles P (1989), Manias, Panics and Crashes, A History of Financial Crisis, New York, Basic Books.
Kinoshita, Noriaki (2006), Government Debt and Long-Term Interest Rates, IMF Working Paper. 2006, Bd. 06/63.
Krueger, Anne O. (2002), A New Approach To Sovereign Debt Restructuring, International Monetary Fund, Washington.
Manmohan S. Kumar, Jaejoon Woo (2010), Public debt and growth, IMF Working Paper WP/10/174.
Niskanen, William A. (1971), Bureaucracy and Representative Government, New York.
Ostry, Jonathan D., et al. (2010), Fiscal Space. IMF Staff Position Note 10/11, September 1.
o.V. (2008), EU-Norm zum Krümmungsgrad der Gurke fällt weg, Der Tagesspiegel, URL www.tagesspiegel.de/weltspiegel/eu-norm-zum-kruemmungsgrad-der-gurke-faellt-weg/1370166.html
Paoli, Bianca De; Hoggarth, Glenn und Victoria Saporta (2006), Costs of sovereign default. Bank of England Quarterly Bulletin, July 2006.
Reinhart, Carmen M.; Rogoff, Kenneth (2009), This Time is Different. Eight Centuries of Financial Folly, Princeton and Oxford.
Reinhart, Carmen M.; Rogoff, Kenneth S.; M. Savastano (2003), Debt intolerance. NBER Working Paper, Bd. No. 9908.
Rogoff, Kenneth; Zettelmeyer, Jeromin (2002), Bankruptcy Procedures for Sovereigns: A History of Ideas, 1976-2001, IMF Working Paper 02/133.
Rogoff, Kenneth (2011), Einige Länder sollten eine Auszeit nehmen, in: FAZ, 10.02.2011, Nr. 34, S. 12.
Rose, Andrew K. (2005), One Reason Countries Pay Their Debts: Renegotiation and International Trade. Journal of Development Economics. Bd. Vol. 77, No. 1 (June), S. 189 – 206.
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2008), Die Finanzkrise meistern – Wachstumskräfte stärken, Jahresgutachten 2008/09, Wiesbaden.
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007), Staatsverschuldung wirksam begrenzen. Expertise im Auftrag des Bundesministers für Wirtschaft und Technologie, Wiesbaden: s.n., 2007.
Seidel, Martin (2009), Der Euro – Schutzschild oder Falle? Kann die EWU-Mitgliedschaft eines Landes bei Überschuldung und permanenten Leistungsbilanzdefiziten aufgehoben werden? In: List-Forum für Wirtschafts- und Finanzpolitik, Band 35, Heft 2-4, S. 148-172.
Shleifer, Andrei (2003), Will the Sovereign Debt Market Survive? In: American Economic Review, Vol. 93, 2003, S. 85-90.
Wagner, Adolph (1892), Grundlegung der politischen Oekonomie, 3. Auflage, 1, Theil, Leipzig.
Wentzel, Dirk (2005a), Zur Begrenzung der Staatsverschuldung nach dem Scheitern des Stabilitätspaktes, in: Wirtschaftsdienst, 85. Jahrgang, Heft 9, September 2005, 605-612.
Wentzel, Dirk (2005b), Der Stabilitäts- und Wachstumspakt: Prüfstein für ein stabilitätsorientiertes Europa, in: Wentzel, Dirk und Helmut Leipold (Hg.), Ordnungsökonomik als aktuelle Herausforderung, Schriften zu Ordnungsfragen der Wirtschaft, Band 78, S. 311-331.
Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft (BMWi): Überschuldung und Staatsinsolvenz in der Europäischen Union, Gutachten Verabschiedet durch den Beirat am 26. November 2010.
Zusammenfassung
Vor dem Hintergrund ausufernder europäischer Staatsverschuldung und der Euro-Krise wird das Konzept einer Insolvenzordnung für Staaten vorgestellt. Der Beitrag skizziert das Grundmuster einer solchen Insolvenzordnung, zeigt Verknüpfungen zu anderen wirtschaftlichen Teilordnungen auf und diskutiert entsprechende Pro- und Contra-Argumente. In Verbindung mit einer staatlichen Insolvenzordnung wird die Idee präsentiert, dass die internationale Staatengemeinschaft eine supranationale Versicherungsgesellschaft gründet, die einzelne Staatsanleihen gegen einen Zahlungsausfall absichert. Länder mit schlechten wirtschaftlichen Daten und hoher Verschuldung müssen dabei höhere Prämien zahlen, so dass ein direkter materieller Anreiz zu solider Staatsführung besteht.
Summary
With reference to the current European crisis of highly indebted states and a common currency under pressure, the concept of a bankruptcy code for states is presented. The article examines the principles of such a code, analyzes interdependencies to other institutional parts of the economy and financial markets and discusses all pros and cons of such a proposal. Connected to the framework of a bankruptcy code, the idea of an international insurance system for government bonds is developed. Countries with poor economic performance and a high debt ratio have to pay higher premiums so that a direct incentive exists in order to implement a more solid budget policy.
Zusammenfassung
In diesem Vortrag werden wichtige Aspekte makroökonomischer Politik, insbesondere Geld- und Fiskalpolitik, in der aktuellen Krise diskutiert.
Die Geldpolitik in Europa reagiert deutlich auf die Krise, durch extensive Bereitstellung von Liquidität und Aufkauf von Staatspapieren. Studien zur Wirksamkeit der Geldpolitik lassen erwarten, dass diese einen nennenswerten Beitrag leisten kann. Die Wirkung der Geldpolitik ist allerdings asymmetrisch, d.h. manche Länder in der Eurozone profitieren mehr als andere. Der Aufkauf von Staatspapieren durch die EZB ist bedenklich und kaum mit unabhängiger Geldpolitik vereinbar. Der Wechselkurs sollte keine primäre Zielgröße für die Politik sein.
Die Fiskalpolitik wird expansiv eingesetzt, primär werden die Ausgaben erhöht. Es ist zu erwarten, dass deutliche Wirkungen auf die wirtschaftliche Aktivität davon ausgehen. Die existierenden Schätzungen des fiskalischen Multiplikators für Deutschland, die auf vergangen Daten beruhen, sind vermutlich zu klein. Die extensiven Garantien, die Deutschland im Rahmen der staatlichen Schuldenkrise gegeben hat, engen allerdings den Spielraum für expansive Fiskalpolitik deutlich ein. Deutschland ist zu dem wesentlichen fiskalischen Anker in Europa geworden und wenn nur der Verdacht einer zu großen Verschuldung aufkommt, dann ist das Eurogebiet tatsächlich existentiell bedroht.
In den Börsensälen herrscht Panik, vor den Börsen campiert die Occupy-Bewegung. Die Teilnehmer dieser Bewegung kritisieren nicht mehr nur die Finanzmärkte, sie stellen auch das System, ja sie stellen unsere Wirtschaftsordnung in Frage. Es drängt sich die Frage auf: Ist unser System überhaupt noch zeitgemäß?
Die Marktwirtschaft hat mehr Menschen ein Leben in Gesundheit, mit guter Bildung und guten Einkommenschancen verschafft als irgendeine andere Wirtschaftsordnung. Damit entspricht die Marktwirtschaft den Kriterien der Verantwortungsethik (Max Weber), nach der das Ergebnis und nicht die Motive des Handelns für die Bewertung ausschlaggebend sind. Trotz des geschaffenen Wohlstandes zeigen Umfragen, dass in der Bevölkerung erhebliches Unbehagen gegenüber der marktwirtschaftlichen Ordnung und der aus ihr resultierenden Einkommensverteilung verbreitet ist.
Die soziale Marktwirtschaft deutscher Prägung war immer nur begrenzt sozial und nur begrenzt marktwirtschaftlich. Seit es nicht mehr dauernd nur nach oben geht, nehmen die Beschwerden über „das System“ zu. Was wir brauchen, ist aber keine neue Ordnung. Wir müssen die gute soziale Marktwirtschaft nur verlässlich etablieren und leben. Der Staat muss den Wettbewerb optimieren. Wer Subventionen zahlt und Konkurse nicht zulässt, wer auch leistungs- und lernfähige Menschen mit Transfers zu verminderter Anstrengung verführt, der denaturiert die soziale Marktwirtschaft. Fehlentwicklungen sind aber auch im Finanzsektor zu beklagen. Gierige Akteure haben es geschafft, dass System an den Rand des Abgrundes zu führen. Dies gilt es zu korrigieren, nicht die soziale Marktwirtschaft abzuschaffen.
Wir brauchen den Diskurs über die moralischen Aspekte unserer Wirtschaftsordnung. Vielen, zu vielen erscheint das Begriffspaar „Markt und Moral“ als logischer Widerspruch. Nachdenklich muss stimmen, dass selbst Absolventen wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge selten Antworten auf die Frage nach den moralischen und ethischen Grundlagen unserer Wirtschaftsordnung geben können. Dabei generiert Marktwirtschaft Moral, sie braucht aber auch moralische Akteure. Generell gilt die These von Karl Homann, dass in der Marktwirtschaft der systematische – nicht der einzige – Ort der Moral die Rahmenordnung ist. Primär liegt im marktwirtschaftlichen System die Moral also in den Spielregeln, die Effizienz dagegen in den Spielzügen. Mit einer effizienten Regulierung allein ist es jedoch nicht getan, der Einzelne darf sich auch bei einer guten Rahmenordnung seiner moralischen Verantwortung nicht entziehen.
Die ordnungspolitische Debatte sollte künftig differenzierter ausfallen als in der Vergangenheit, denn die großen Grundsatzschlachten über Marktwirtschaft vs. Planwirtschaft sind geschlagen. Es gilt deutlich zu benennen, was der Markt leisten kann. Es gilt aber auch die Spannungsfelder herauszuarbeiten, auf denen die Devise „Mehr Markt, weniger Staat“ nicht zu befriedigenden Ergebnissen geführt hat.
Die Finanz- und Schuldenkrise hat unmissverständlich verdeutlicht, dass die Marktwirtschaft ohne traditionelle Werte wie Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit nicht funktionieren kann. Vertrags- und Wortbrüche sind keine Basis für die marktwirtschaftliche Ordnung. Spätestens mit der Lehman-Pleite ist aus der Wirtschafts- eine handfeste Vertrauenskrise geworden. Da sowohl der Finanzsektor (inkl. Notenbanken) als auch die Politik von der Vertrauenskrise erfasst worden sind, spricht wenig für ein schnelles Ende der Krise. Denn Vertrauen geht schnell verloren, doch es lässt sich nur sehr langsam wiederbeleben.
Dr. Hermann Otto Solms, MdB
Vizepräsident des Deutschen Bundestages
Vorsitzender des Arbeitskreises Wirtschaft und Finanzen
der FDP-Bundestagsfraktion
11011 Berlin
Platz der Republik 1
Tel. (030) 227 - 77 456
Fax (030) 227 - 76 430
www.hermann-otto-solms.de
Vortrag für den Stiftungstag der Doris und Dr. Michael Hagemann-Stiftung am Donnerstag dem 8. Dezember 2011
Kurzfassung
Ist der Euro noch zu retten?
Zu den Möglichkeiten und Grenzen staatlichen Handelns
Die europäische Staatsschuldenkrise ist im Kern eine Vertrauenskrise – es bröckelt das Vertrauen in die finanzpolitische Handlungsfähigkeit einiger Eurostaaten, letztlich in ihre Wettbewerbsfähigkeit. Wer jetzt nur die Finanzmärkte an den Pranger stellt, macht es sich zu einfach. Nicht die Finanzmärkte haben die Handlungsspielräume der Politik beschnitten, sondern eine demokratisch selbstbestimmte aber gleichwohl verfehlte Finanzpolitik der Vergangenheit. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt, der ein Auseinanderdriften und eine übermäßige Verschuldung der Staaten bereits im Vorfeld verhindern sollte, wurde - auch unter deutscher Mitwirkung - bereits 2003 entscheidend geschwächt. Durch ausufernde Staatsverschuldung haben sich die Staaten in zu große Abhängigkeit von den Finanzmärkten gebracht.
Die europäische Staatengemeinschaft steht nun in doppelter Hinsicht vor einer schwierigen Aufgabe: einerseits muss die akute Krise entschärft werden und andererseits müssen Lehren aus den Fehlern der Vergangenheit gezogen werden. Die Schönwetterkonstruktion des Stabilitäts- und Wachstumspaktes muss in eine zukunftsfeste Ordnung überführt werden.
Dabei stehen sich zwei grundlegende politische Auffassungen von der Integration Europas diametral gegenüber. Soll die Integration demokratisch, von unten geschehen - oder zentralistisch, von oben dirigiert? Der liberale Entwurf von Europa gründet in der Idee der Freiheit. Waren, Dienstleistungen, Kapital und Menschen sollen ungehindert die Grenzen überqueren können. Private Eigentumsrechte sind geschützt. Wirtschaftliche Verflechtung in Europa stabilisiert den Frieden. Die liberale Ordnung ist eine spontane. Die sozialistische Vision hingegen will vorschreiben und bevormunden. Das Ziel ist ein europäischer Zentralstaat, der nach außen protektionistisch und nach innen interventionistisch agiert. Die sozialistische Ordnung ist eine gelenkte. Sie verlangt eine große Machtfülle für die Politik und versierte Technokraten. In ihr wird Integration von oben bewirkt durch vereinheitlichte Regeln und durch Umverteilung.
Das Kräftemessen zwischen diesen beiden Polen war in der Geschichte der europäischen Integration stets virulent - so auch in dieser vielleicht schwersten Krise seit Einführung des Euros, wenn nicht sogar seit der europäischen Einigung. Gerade angesichts dieser Tragweite ist die Orientierung an elementaren ordnungspolitischen Prinzipien um so zwingender. Wir müssen verhindern, dass die Krise instrumentalisiert wird, den grundlegenden Charakter der Währungsunion zu verändern.
Eine Transfer- und Schuldenunion wäre nicht nur ökonomisch falsch, sie würde die demokratische Grundlage, auf der Europa fußt, untergraben. Die politische Willensbildung vollzieht sich auf örtlicher, nationaler oder europäischer Ebene. Die jeweiligen Parlamente sind der Ort demokratisch legitimierter Entscheidungen. Entscheidungen dürfen nicht auf Gremien übertragen werden, die keine demokratische Legitimation besitzen und sich keiner Wahl stellen müssen. Entscheidungen sind dort zu treffen, wo auch die finanziellen Folgen vor den Bürgern zu verantworten sind. Wer Risiken eingeht, beispielsweise durch Verschuldung des Haushaltes, muss dafür grundsätzlich die Verantwortung tragen. Sie darf nicht auf andere abgewälzt werden. Die Verlagerung von Haftung auf eine gemeinschaftliche Ebene etwa durch Eurobonds verstößt nicht nur gegen das Subsidiaritätsgebot sondern auch gegen das Demokratieprinzip. Mit den Kriterien ökonomischer Effizienz ist sie ohnehin nicht vereinbar.
Jenseits der Bewältigung und Finanzierung der akuten Krise muss es darum gehen, die Grundidee des Stabilitätspaktes durchzusetzen und zu erhärten. Das gelingt nur, wenn wir an den Ursachen ansetzen. Die Schuldenproblematik ist langfristig nur lösbar, wenn gleichzeitig in den betroffenen Ländern die tiefer liegenden Probleme mangelnder Wettbewerbsfähigkeit und fehlender Ausgabendisziplin gelöst werden.
Die Krise der Eurozone lässt sich nicht mit einem Paukenschlag lösen. Die hohe Staatsverschuldung auch in Deutschland wurde über Jahre aufgebaut. Der Schuldenabbau wird wiederum Jahre benötigen. Es wäre verfehlt, in einer Art von marktwirtschaftlichem Rigorismus jede Art von Hilfe zu verweigern. Das würde einen schnellen Zusammenbruch der Finanzmärkte auslösen. Völlig Unbeteiligte würden dabei massiv in Mitleidenschaft gezogen. Im Ergebnis wäre das eine Lösung zu Lasten Dritter. Das entspräche nicht dem marktwirtschaftlichen Prinzip der Deckung von Haftung und Risiko. Hilfe ist richtig, wenn ein Mitglied der Eurozone trotz Reformanstrengungen den Zugang zum Kapitalmarkt zu verlieren droht. Aber jede Art von Hilfe birgt im Kern ein Moral Hazard Problem: Sie verleitet dazu, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Deshalb darf es keine bedingungslose Hilfe geben, sondern nur Zug um Zug gegen die Einhaltung von Auflagen. Jede Hilfe muss zur Eigenverantwortung und Selbstbestimmung zurückführen. Wir müssen den Weg eines geordneten Abbaus der Schulden und zurück zur finanziellen Stabilität in Europa gehen. Dann wird das Vertrauen der Märkte auch wieder zurückkehren
Schuldenschnitt, Rekapitalisierung der Banken, zweites Griechenlandpaket, Kredithebel, Zweckgesellschaft, Kreditversicherung – dies sind die wichtigsten Instrumente, manche reden auch von Finanz-Alchimie -, mit denen die Staats- und Regierungschefs der Eurozone nach ihrem zweistufigem Gipfelmarathon am 23. und 26. Oktober 2011 die Staatsschuldenkrise in Europa in den Griff bekommen wollen. Nach einer kurzen Euphorie der Finanzmärkte nahmen die Anleihekurse der überschuldeten Euroländer – wie bereits nach dem vorangegangenen Krisengipfel am 21. Juli 2011 - ihre Talfahrt wieder auf und die Aktienkurse gaben wieder deutlich nach. Das Sprichwort von der Krise nach der Krise scheint sich nirgends so schnell zu bewahrheiten wie bei der europäischen Schuldenkrise.
Der im Vorfeld von vielen apostrophierte Befreiungsschlag hat seine Wirkung auf die Finanzmärkte offenbar erneut verfehlt. Der Befreiungsschlag stellt sich mehr und mehr als ein Schlag ins Wasser heraus. Selbst die in letzter Minute eingebrachte finanzielle Stärkung des Euro-Rettungsschirms EFSF über einen sog. Hebel auf über eine Billion Euro, d.h. auf die kaum noch fassbare Summe von 1000 Milliarden Euro, hat die Gläubiger wohl wenig überzeugt, ihre Anleihen überschuldeter Peripherieländer nicht abzustoßen. Mangels Interesse der potentiellen Investoren wird die Hebelwirkung nunmehr auch deutlich geringer ausfallen als erhofft. Bereits die ursprüngliche Ratio des Rettungsschirms mit einem effektiven Volumen von 220 Mrd. Euro, allein seine Existenz würde die Marktteilnehmer beeindrucken und deshalb niemals zum Einsatz kommen, hat sich als fataler Irrtum erwiesen.
Allerdings haben sich die Staats- und Regierungschefs der Eurozone immerhin zu der Erkenntnis durchgerungen, dass auch souveräne Staaten zahlungsunfähig werden können. Mit dem von den privaten Gläubigern griechischer Staatsanleihen geforderten Verzicht auf 50 % des Nennwertes ihrer Anleihen ist das jahrzehntelange Dogma von Staatsanleihen als sicherstem Aktivum endgültig vom Thron gestoßen. Damit werden das Kursrisiko dieser toxischen Aktiva und der Marktmechanismus wieder virulent. Das Anleiheverhalten privater Investoren wird sich in Zukunft wieder stärker in entsprechenden Risikoaufschlägen bei Anleihen überschuldeter Euroländer niederschlagen. Der Sanktionsmechanismus der Finanzmärkte kann die Emittentenländer entsprechend disziplinieren, um eine zuverlässigere Konvergenz zwischen den Mitgliedstaaten zu erreichen.
Dieser Mechanismus wird jedoch nicht nur durch die direkte Finanzierung der Haushaltsdefizite der Peripherieländer durch den EFSF außer Kraft gesetzt. Auch die massiven Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank – innerhalb weniger Monate von 90 Mrd. Euro auf 200 Mrd. Euro in die Höhe geschossen – hebeln den Sanktionsmechanismus der Märkte aus und unterstützen letztlich die Fehlsteuerung in der Finanzpolitik der Schuldnerländer. Die EZB kann allerdings ihre von vielen als letzten Ausweg angesehene Funktion als „lender of last resort“ auch nicht ad infinitum fortsetzen. Die notwendigen Abschreibungen auf die „junk bonds“ in ihrem Portefeuille lassen ihr Kapital erodieren, so dass eine Rekapitalisierung selbst der EZB auf Kosten der Regierungen bzw. Steuerzahler notwenig wird. Die durch die Anleihekäufe ausgelöste Liquiditätsschöpfung bildet ein Inflationspotential, das früher oder später akut werden kann. Die Leidtragenden sind dann letztlich die Steuerzahler und die Sparer.
Selbst Frankreich gerät mehr und mehr ins Visier der Ratingagenturen und der Märkte. Der Zinsaufschlag gegenüber Bundesanleihen ist mit 200 Basispunkten auf den höchsten Wert seit über 15 Jahren gestiegen. Der unter dem Druck der Märkte in Angriff genommene Defizitabbau ist zu zaghaft und beruht im wesentlichen auf Einnahme- verbesserungen. Dabei ist Frankreich in der EU schon das Land mit der höchsten Steuerlast. Auf anderen Baustellen wie Wettbewerbsfähigkeit, Jugendarbeitslosigkeit und Deindustrialisierung wird überhaupt noch nicht gearbeitet. Das von der Regierung Sarkozy beschworene Leitmotiv, dem deutschen Beispiel zu folgen, steht nur auf dem Papier. Bei einer Herabstufung der Bonitätsnote AAA für Frankreich durch die Ratingagenturen würde selbst der bescheidene Defizitabbau rasch zur Makulatur. Der einsetzende Zinsanstieg würde einen circulus viciousus steigender Defizite und steigender Risikoprämien bzw. Zinsen in Gang setzen. Der EFSF würde seine AAA - Bonität verlieren und die vor 1 ½ Jahren eingeleitete Strategie zur Überwindung der Schuldenkrise implodieren.
Bei dem Einsatz immer neuer Finanztechniken gerät die Bekämpfung der eigentlichen Krisenursache, die überbordende Staatsverschuldung, fast in Vergessenheit. Die von Merkel und Sarkozy im Rahmen einer nunmehr echten „gouvernance économique“ geforderte Einführung einer Schuldenbremse führt sich schon deshalb ad absurdum, da sie nicht mal in Frankreich eine Chance auf Billigung durch das Parlament hat. In den südlichen Schuldnerländern laufen die Konsolidierungsprogramme von EU und IWF aus dem Ruder.
Die Gemeinschaftsmethode zur Sicherung der Konvergenz – die sog. peer pressure – hat sich als ineffizient erwiesen. Die innenpolitische Opportunität hatte jeweils Vorrang vor dem Gemeinschaftsinteresse. Das Instrumentarium von Maastricht kam nie angemessen zur Anwendung. Es ist zweifelhaft, ob der Primat der nationalen Politik jemals zugunsten der Gemeinschaftsebene überwunden werden kann. Dazu wären vor allem strikte Automatismen für die nationalen Politiken zur Neutralisierung der politischen Opportunität notwendig. Diese werden aber nicht nur vom französischen Staatspräsidenten entschieden abgelehnt.
Die Zweifel an der Wirksamkeit der Gemeinschaftsmethode gelten auch für die neuen Anläufe zur Verstärkung der Konvergenz, wie sie auf der Tagesordnung des Krisengipfels am 8. und 9. Dezember 2011 stehen. Die von der Bundeskanzlerin geforderte Änderung des EU-Vertrages braucht Zeit, sofern sie überhaupt zustande kommt. Die aktuelle Krise erfordert aber rasche Lösungen. Zudem erinnert man sich gerade in Deutschland an das historische Datum des 10. Mai 2010, als in einer Nacht-und-Nebelaktion unter französischem Vorsitz alle Sicherheitsregeln des Vertrages von Maastricht über Bord geworfen wurden. Die alternativ ins Auge gefassten bilateralen Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten führen zu einer Fragmentierung nicht nur der EU, sondern auch der Eurozone selber.
Nach dem Fall des Dogmas immer zahlungsfähiger Staaten müssen wir uns langsam auch an den Gedanken gewöhnen, das Undenkbare zu denken, dass die Zusammensetzung der Euro-Gruppe nicht für alle Ewigkeit in Stein gemeißelt ist. Dies gilt um so mehr, als sich die Erkenntnis noch nicht in allen Mitgliedsatten durchgesetzt hat, dass die europäische Wirtschafts- und Währungsunion ein Modell sui generis ist mit einer zentralisierten Geldpolitik und dezentralen Finanz- und Wirtschaftspolitiken. Ihre Funktionsfähigkeit erfordert einen Verzicht auf nationale Souveränität in zentralen Politikbereichen. Schließlich geht es um die Wahl zwischen schmerzhaften Abstrichen an nationaler Autonomie oder Zerfall der Eurozone. So unbequem manchen Politikern auch die Erkenntnis sein mag, dass allein politischer Wille ökonomische Gesetzmäßigkeiten nicht überspringen kann, so gilt ohne Einschränkung weiterhin, was bereits vor 100 Jahren der österreichische Nationalökonom Eugen von Böhm-Bawerk feststellte: „Macht allein kann sich eine Zeit lang behaupten, letztlich setzt sich aber das ökonomische Gesetz durch“.
Wir danken allen Referenten für die Vorträge! Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Vorträge das geistige Eigentum der Autoren bleiben. Auf die sorgfältige Beachtung des Copyright wird besonders aufmerksam gemacht.